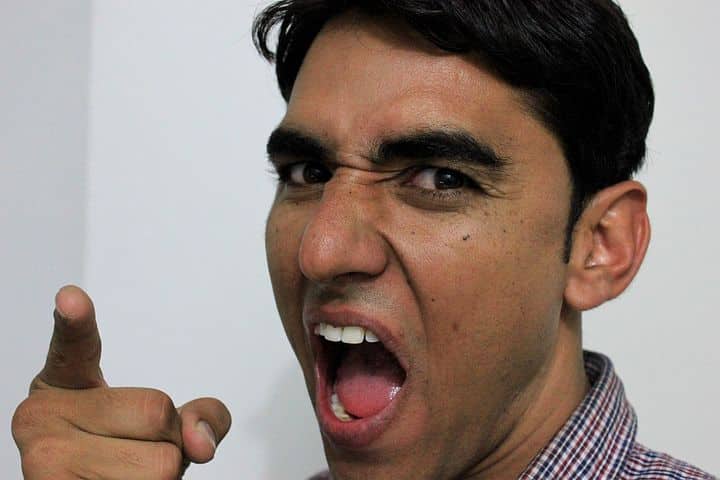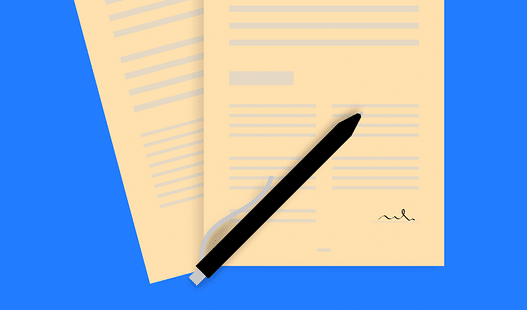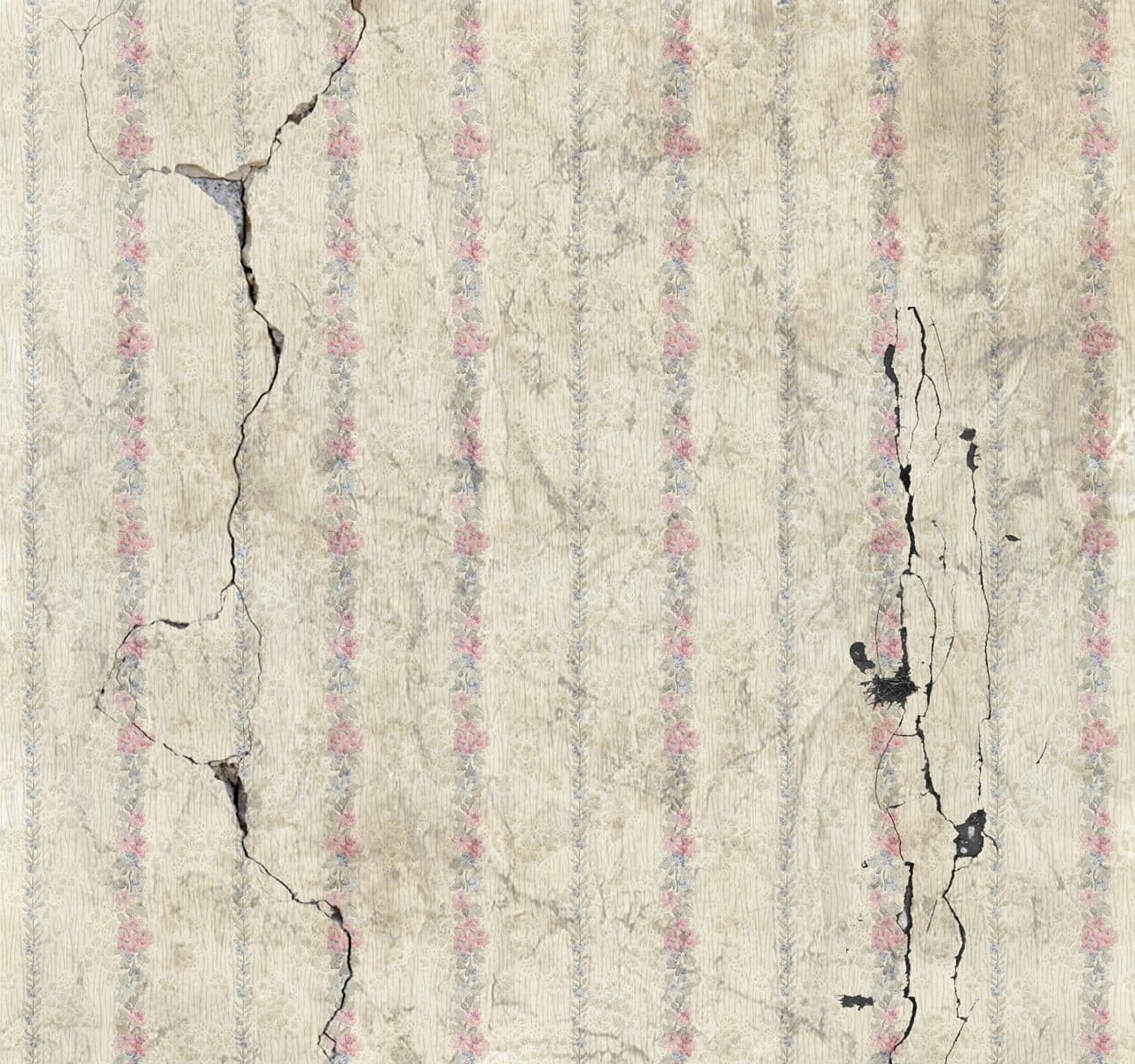Höhe des Verdienst ist nicht unbedingt Indiz für Selbständigkeit
Bauunternehmer scheiterte mit Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
Widersprüche gegen Sozialversicherungsbescheide, die Beiträge nachfordern, haben zunächst Mal keine aufschiebende Wirkung, sodass die geforderte Summe zu zahlen ist. Dann muss ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden Wegen der hohen Anforderung ist er aber nur mithilfe fachkundiger Unterstützung zu gewinnen, wie der folgende Fall des Sozialgericht Oldenburg einmal mehr zeigt (S 81 BA 28/18 ER).
Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung
Helfen kann hier nur ein entsprechender Antrag an Sozialgericht, wobei argumentiert werden muss, dass der Bescheid entweder offensichtlich rechtswidrig ist oder das private Interesse des Antragstellers an der Nichtvollziehung höher zu bewerten ist als das staatliche Vollzugsinteresse.
Subunternehmer hier keine Selbständigen
Vorliegend scheiterte ein Trockenbauer mit seinem Geschäftsmodell ausländische Mitarbeiter als Subunternehmer einzusetzen. Mit seiner Argumentationen, sie seien selbständig, da sie im Vergleich zu seinen Angestellten mehr verdienen würden, drang der Arbeitgeber auch nicht durch.
Soziale Absicherung miteinpreisen
Jedenfalls nicht bei 26 Euro Stundenlohn auf dem Bau. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Umstand, dass der Verdienst teilweise über dem tarifvertraglich geschuldeten Lohn für abhängig Beschäftigte lag, reichte dem Sozialrichter nicht. Die Höhe des hier in Rede stehenden Verdienstes sei nämlich hier nicht geeignet, ein Indiz für eine selbständige Tätigkeit der Mitarbeiter abzugeben. Denn die Höhe des von einem Subunternehmer erzielten Verdienstes kann bei der Beurteilung des sozialversicherungsrechtlichen Status nur dann als Indiz für eine selbständige Tätigkeit gewertet werden, wenn er den Bruttolohn eines vergleichbare Arbeiten verrichtenden Arbeitnehmers derart massiv überschreitet, dass aufgrund der Höhe des Verdienstes sowohl eine soziale Absicherung bezahlt werden kann, die mit dem Sozialversicherungsschutz von Arbeitnehmern vergleichbar ist, als auch typische Unternehmenskosten gedeckt werden können (wie insbesondere die Beschäftigung eigener Arbeitnehmer, die Unterhaltung einer eigenen Betriebsstätte, die Buchhaltung und sonstige Verwaltung des Unternehmens, Kosten für Werbung und gegebenenfalls auch Investitionen in das eigene Unternehmen).
Tipp vom Anwalt: Maßgebend für den Sozialversicherung rechtlichen Status ist stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Für eine abhängige Beschäftigung spricht, wenn. “Subunternehmer” über längere Zeiträume ganz regelmäßig für einen Arbeitgeber tätig sind. Für den Status einer abhängigen Beschäftigung spricht weiterhin, wenn “Subunternehmer” Tätigkeiten ausüben, die zum normalen Betrieb des Arbeitgeber gehören.
Hier geht es zu unserem ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/sozialrecht/
Bei zu kleinen Wohnungen Miete zurückerhalten
Mietminderung bei zu kleiner Wohnfläche
Bekanntlich können bei Balkonen, Terrassen und Dachgärten nur ein Viertel der Fläche berücksichtigen werden. In einem aktuellen Fall vor Landgericht Berlin vom 17.01.2018 (18 S 308/13) wurde es einem Vermieter zum Verhängnis, als er die Miete um 64, 60 Euro auf die ortsübliche Miete von 507,60 Euro anheben wollte.
Mieter erhält über Widerklage Miete zurück
Nicht nur, dass seinem Ansinnen die Kappungsgrenzverordnung entgegenstand, das Gericht nahm eine von Anfang an geminderte Miete an. So konnte der Vermieter nicht nur die gewünschte Mieterhöhung nicht voll durchsetzen, sondern musste wegen einer erfolgreichen Widerklage dem Mieter die überhöhte Miete aus drei Jahren, immerhin über 1700 Euro zurückzahlen!
Hier geht es zu unserem Ressort Mietrecht
Tipp vom Anwalt: Beachten Sie die klaren Vorgaben der Wohnflächenverordnung (WoFlV). Gem. dessen § 4 sind nur die Grundflächen
von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens zwei Metern vollständig, die von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens einem Meter und weniger als zwei Metern jedoch nur zur Hälfte und von unbeheizbaren Wintergärten und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen nur zur Hälfte zu berücksichtigen. Bei Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind es in der Regel sogar nur ein Viertel!
Update: Nach einer neueren BGH-Entscheidung sind die Wohnflächenverordnung auch bei nichtpreisgebundenen Wohnraum immer heranzuziehen, denn – so wird angedeutet – können die DIN 283 oder 277 der II. Berechnungsverordnung auch über eine örtliche Übung oder eine Verkehrssitte nicht allgemeingültig werden, da diese keine in sich geschlossen Regelwerke ohne Wertungswidersprüche seien (BGH vom 17.04.19, Az.: VIII ZR 33/18).
Schmu bei den Investitionskosten für das Pflegeheim
Investitionskosten nach § 82 SGB XI
Pflegeheime dürfen nach § 82 III SGB XI ihre Investitionskosten auf die Heimbewohner umlegen. Dabei sind aber auch Grenzen einzuhalten.
Kosten müssen tatsächlich angefallen sein
Nur tatsächlich angefallene Kosten, die weder durch Vergütungen oder Entgelte noch mittels Förderung durch die Länder abgegolten sind, dürfen dem Pflegebedürftigen auferlegt werden (vgl. u.a BSG vom 08.09.2011, Az.: B 3 P 4710 R). Daher dürfen etwa fiktive Zinsen auf das im Eigentum eines Einrichtungsträgers stehende Betriebskapital auf keinen Fall den Heimbewohnern in Rechnung gestellt werden und auch grundsätzlich keine bloßen Pauschalen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (so BSG vom 08.09.2011, Az.: B3 P2/11 R).
Kosten müssen betriebsnotwendig sein
Die Kosten müssen dabei auch betriebsnotwendig gewesen sein, so dass die Pflegeheime auch insoweit beschränkt sind (vgl. hierzu zuletzt etwa BSG vom 28.9.2017, B 3 P 4/15 R). Dass muss bei der Vergrößerung des Fuhrparks immer beachtet werden.
Zuwendungen Dritter berücksichtigen
Zweckgerichtete Zuwendungen Dritter zu den Investitionskosten verringern auf jeden Fall die Forderung gegenüber den Pflegebedürftigen und dürfen nicht zum Aufbau von Eigenkapital oder der Bildung für Rückstellung für erst in Zukunft anfallende Investitionen umgewidmet werden.
Neuerkrankung nach Rentenantragsstellung
Rentenversicherungsrecht
Bei sozialgerichtlichen Klageverfahren von nicht selten vielen Jahren tritt öfters die Situation ein, dass beim Kläger oder der Klägerin eine Krankheit hinzutritt, die die ganze Situation in einem neuen Licht erscheinen lässt. In der hier dargestellten Entscheidung hatte das Sozialgericht Neubrandenburg über die Klagänderung eines mittlerweile 60-jährigen Mannes zu entscheiden der seit fast 7 Jahren um seine Erwerbsminderungsrente kämpfe (S 2 R 136/13).
EU-Rente nach Arbeitsunfall
Der damals 53-Jährige wollte nach einem Arbeitsunfall volle EU-Rente nach § 43 SGB VI erhalten, jedoch war der Sozialrichter nicht davon überzeugt, dass er dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht wenigstens sechs Stunden täglich zur Verfügung stehen könnte. Der Mann war in seinem bisherigen Berufsleben nach einer Tätigkeit als Beschäftigungstherapeut als Sozialarbeiter und zuletzt als Biogasanlagenfahrer in sehr verschiedenen Berufen tätig und daher wirklich anpassungsfähig.
Psychische Erkrankung als Rentenleistungsfall
Nach der mündlichen Verhandlung trug der Mann vor, dass er eine psychische Erkrankung entwickelt habe und nun (auch) wegen diesen Umstandes erwerbsunfähig sei. Sein Anwalt versuchte nun die Klage noch zu ändern. Das Sozialgericht sah darin aber keine Sachdienlichkeit, weil zwischen ursprünglichem Antrag (Antrag auf EM-Rente und Sachverhalt) und dem jetzigen behaupteten Leistungsfall viele Jahre lägen. Das neue Krankheitsgeschehen stelle daher eine Zäsur da, die mit dem ursprünglichen Rentenantrag nicht in unmittelbaren Zusammenhang stehe.
Neuer Rentenantrag und neues Widerspruchsverfahren
Der Kläger habe also einen neuen Rentenantrag bei der Rentenversicherung zu stellen und im Falle dessen Ablehnung das Widerspruchsverfahren zu durchlaufen. Mit der ersten Ablehnung habe die Rentenversicherung nicht “Nein heißt Nein” sagen wollen – also dass sie unter keinen Umständen bereit sei eine Rente zu zahlen – sondern nur, dass dies im ursprünglich umrissenen Leistungsfall verneint wird.
Daher wurde die Klage des Mannes abgewiesen und er blieb auf seinen Anwaltskosten sitzen.
Hier geht es zu unserem Ressort Rentenversicherungsrecht: Rentenrecht
Arbeitnehmer auf Abwegen verlieren Unfallversicherungsschutz
Unfallversicherung bei Wegeunfall
Wer kennt das nicht? Todmüde von der Arbeit heim, im Zug einschlafen und dann ein paar Stationen weiteraufwachen als man eigentlich aussteigen wollte. Das Thüringische Landessozialgericht hat jetzt entschieden, dass im Falle eines Unfalls in diesem Fall kein Unfallversicherungsschutz bestehen kann. Der im Sozialrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. stellt Ihnen dieses interessante Urteil vor.
Von Zug erfasst auf Nachhauseweg
Eine Mittvierzigerin, Fleischfachverkäuferin, kehrte nach der Frühschicht und vorangegangener Tagschicht übermüdet nach Hause. In der Regionalbahn schlief sie ein und erwachte erst wieder eine Station später als geplant. Zu dem auf dem anderen Gleis stehenden Zug – in entgegengesetzter Richter – nahm sie die Abkürzung über die Gleise und wurde durch eine rangierende Lok erfasst und so stark verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.
Klage auf Hinterbliebenenleistungen nach § 63 I SGB VII
Die Klage der Hinterbliebenen auf Gewährung von Hinterbliebenenleistungen nach § 63 I 1 SGB VII wurde nun von den Sozialrichtern abgewiesen. Die Frau habe sich nämlich auf einem Abweg – in entgegengesetzter Richtung – zum Nachhauseweg befunden. Als der Unfall passierte sei sie auch noch nicht auf den gewöhnlichen Nachhauseweg zurückgekehrt.
Abweg oft nicht versichert
Ein Umweg, also ein verkehrsbedingtes Ausweichen, sei ebensowenig der Grund für das Weiterfahren gewesen, wie ein “betriebsbedingter Schlafmangel”. Damit wichen die Richter von einer Entscheidung des Sozialgericht Gelsenkirchen ab (Az.: S 13 U 53/02), wo eine Arbeitnehmerin nach einer Nachtschicht auch auf dem Nachhauseweg einschlief und die Unfallversicherung die verunfallte Klägerin entschädigen musste.
Eigenwirtschaftliche Gründe statt Schichtplan
Hier aber sahen die Sozialrichter eigenwirtschaftliche Gründe für das Einschlafen. Weder der Schichtwechsel, noch äußere Umstände, wie Dunkelheit oder entsprechende Außentemperaturen seien für das Einschlafen wesentlich gewesen.
Tipp vom Anwalt: Versuchen Sie in solchen Situationen unbedingt die damalige Situation vor dem Unfall zu rekapitulieren und trage Sie Umstände vor, die das Einschlafen des Unfallversicherten begünstigt haben.
Wegeunfall nicht auf direkter Wegstrecke
Weil der Unfall nicht auf der üblicherweise genutzten direkten Wegstrecke zwischen Arbeitsstätte und Wohnung erfolgte, war der Wegeunfall hier also nicht versichert.
Hier geht es zu unserem Ressort Sozialrecht
Rechtsprechung reagiert auf osteuropäische Billig-Fuhrunternehmer
Newsletter Transport- und Logistikrecht
Der Newsletter 1/2018 zum Transport- und Logistikrecht der Kanzlei Niggl, Lamprecht & Kollegen befasst sich diesmal schwerpunktmäßig um die wettbewerbsverzerrende Situation durch osteuropäische Billigtransporte und wie die Gerichte hierauf reagieren.
Erbärmliche Situation von Autobahnnomaden
Zum einen geht es um die Entscheidung des EuGH, der den Autobahnnomaden die rote Karte zeigt und zum zweiten die Kabotage-Entscheidung des Amtsgerichtes Köln, die auch gebündelte Teillieferung von ausländischen Logistikunternehmen als unzulässig erklärt.
Als kleines Extra greifen wir die BGH-Entscheidung Anfang letzten Jahres nochmal auf, die die Darlegungslast von geschädigten Frachtführern gegenüber ihren Versicherern auch im Hinblick auf Schäden durch Raubüberfälle weiter verschärft
Regelmäßige wöchentliche Ruhezeit auf Autobahnraststätten
Zunächst die Entscheidung des europäischen Gerichtshof (Az: C-102/16):
Weil Belgien es LKW-Fahrern grundsätzlich verboten hatte ihre wöchentliche Ruhezeit – also nicht die verkürzte – auf Autobahnraststätten zu verbringen, kam es an der deutschen Grenze zu regelrechten Truckercamps, wo auf engstem Raum Hunderte von osteuropäischen LKWs abgestellt wurden und dazwischen gekocht, Wäsche gereinigt und die Freizeit verbracht wurde. Und wenn die Toiletten überfüllt wurden, dann wurde neben die LKWs die Notdurft verrichtet. Genächtigt wurde freilich in der Kabine. Ziemlich erbärmliche Umstände.
Osteuropäisches Fuhrunternehmen klagte gegen Bußgeld
Ein osteuropäisches Fuhrunternehmen klagte nun gegen das Bußgeld von 1.500 € durch eine belgischen Behörde, weil sein Fahrer eben doch die wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden auf einer belgischen Raststätte verbracht hatte. Dessen Argumentation Art. 8 VIII EGVO 561/2006 sehe kein Verbot vor die wöchentliche Ruhezeit im LKW zu verbringen.
Arbeitsbedingungen der Fahrer und Gleichheit im Wettbewerb
Das sah der EuGH anders, der wegen der Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit und der Arbeitsbedingungen der Fahrer sowie der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen im Straßenverkehrsgewerbe sehr wohl ein solches Gebot erkennen konnte.
Kabotagevorschriften werden umgangen
Ein Daueraufreger in der Logistikbranche ist auch die unfaire Billigkonkurrenz durch deren Fuhrunternehmen. Ein 63-jähriger Tscheche wurde nun wegen fahrlässigem Verstoß gegen § 19 IIa Nr. 3 GüKG i.V.m. § 17a GüKGrKabotageV zu einem Bußgeld von 1.000 € verurteilt.
Trickreicher Logistiker aus Osteuropa wurde bestraft
Die Idee war eigentlich genauso simple, wie smart: Ein osteuropäischer Logistiker nahm von verschiedenen Absendern Ware entgegen, disponierte so, dass nur noch eine Fahrt nötig war und trat gegenüber dem BAG als eigener „rechtlicher“ Absender auf, indem er einen Unterfrachtführer beauftragte. Dieser lud die verschiedenen zusammengefassten Teillieferungen nun bei verschiedenen Empfängern in der BRD ab.
Frachtpapiere wurden “frisiert”
In den Frachtpapieren zwischen den Absendern in Tschechien und dem tschechischen Logistiker tauchten noch die tatsächlichen Absender auf – gegenüber dem BAG wurde hingegen nur der tschechische Absender genannt. So wurden dann auf einem 40-Tonner kleinere Mengen an Papierwaren, Bauzubehör und Holz in Paletten an verschiedene Orte im Bundesgebiet verbracht.
Kettenfrachtvertrag wurde zerlegt
Diesen Kettenfrachtvertrag nahm das Amtsgericht Köln jedoch auseinander und verwarf die Idee vom „rechtlichen“ Absender. Abzustellen sei vielmehr auf den „ersten“ Frachtvertrag zwischen tschechischem Absender und tschechischem Logistiker. Zu gut Deutsch: Es kommt auf den tatsächlichen Absender an, also auf dessen Rechnung und in dessen Auftrag der Versand erfolgt. Der Logistiker wurde vom Amtsgericht dabei also zurecht als Güterkraftverkehrsunternehmer enttarnt.
Kabotage
Hintergrund Kabotage: Kabotage ist das Erbringen von Transportdienstleistungen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen Seit dem 14. Mai 2010 gelten innerhalb der EU einheitliche Kabotagebestimmungen. Kabotagebeförderungen im Anschluss an eine Beförderung mit Grenzüberschreitung darf erst nach vollständiger Entladung des Fahrzeuges erfolgen. Innerhalb von drei Tagen nach der Einfahrt in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates mit einem leeren Fahrzeug kann eine Kabotagebeförderung durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass zuvor eine grenzüberschreitende Beförderung in einen anderen Mitgliedstaat durchgeführt wurde und dass die 7-Tage-Frist eingehalten wird.
Ladungsdiebstähle und Ladungsraub
Ein ständiges Ärgernis für international tätige Speditionen ist die Sicherheit vor Ladungsdiebstählen, insbesondere im berüchtigten italienischen Bermuda-Dreieck (Neapel-Bari-Mailand). In dieser Region spielt wohl auch der BHG-Fall des Frachtführers gegen seine Transportversicherung, die unter Berufung auf § 137 I VVG die Zahlung für den Diebstahl der Ware infolge eines Raubes verweigerte (Az.: IV ZR 74/14).
Verladung der Ware ist zu dokumentieren
Der Fahrer wurde übrigens spektakulär bei der Autobahnauffahrt gestoppt und in einem fremden PKW gekidnappt und später irgendwo ausgesetzt. Das Genick brach dem klägerischen Frachtführer der Umstand, das er die Verladung der Ware nur mit einer Rechnung dokumentieren konnte, die zugleich auch Transportbegleitpapier war, aber aber keine weiteren Dokumente, wie Pack- oder Stücklisten oder ein Kommissionierungspapier fehlten. „Eine Abweichung von dem Grundsatz, dass derjenige, der Versicherungsleistungen beansprucht, auch die Beförderung des Transportgutes nach Art und Menge ausreichend zu dokumentieren hat, ist nicht angezeigt“, schreiben die BGH-Richter dem Kläger nüchtern ins Stammbuch. Der Kläger müsse nun mal den eingetretenen Schaden darlegen, was auch den Nachweis von Identität, Art, Menge und Zustand der Gütern umfasse. Für einen Anscheinsbeweis, anders als früher, ließen die Richter keinen Raum mehr (seinerzeit noch zu dem Inhalt von verschlossenen Behältnissen, wie Containern).
Anspruch gegen Transportversicherung
Tipp vom Anwalt: Die Entscheidung setzt die strenge Linie des BGH fort (vgl. BGH 22.05.2014 (Az: I ZR 109/13). Damals wurde entschieden, dass der Fahrer beim Beladevorgang tatsächlich anwesend sein müssen und die geladenen Pakete mitdurchzählen (!) muss, will der Frachtführer bei Ladungsverlusten eine unbeschränkte Haftung vermeiden. Mit der Folge, dass er nunmehr keine Ruhezeit einlegt, sondern arbeitet und der Mindestlohn bezahlt werden muss. Nun muss der Frachtführer auch bei der Handhabung der Lieferpapier und sonstigen Dokumente sehr achtsam sein, will er nicht seinen Versicherungsanspruch gegen die Transportversicherung riskieren.
Dieser Newsletter ersetzt keine steuerliche oder sonstige rechtliche Beratung und soll nur allgemein über die genannten Themen informieren. Wir übernehmen daher keine Gewähr und somit keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität sowie Richtigkeit der Inhalte und Darstellungen.
Haben Sie noch Fragen?
Kontakt: Tel.0931/47085337 oder richter@anwaltskanzlei-wue.de
Kurze rechtliche Fragen werden kostenfrei beantwortet.
Hier geht es zu unserem Ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/transport-und-speditionsrecht/
Ohne Konflikt mit Vermieter als Startup im Homeoffice
Mietrecht für Startups
Für Startups und Existenzgründer sind langjährige Gewerbemietverträge oft ein Graus. Um das finanzielle Risiko zu verringern, wird die eigene Geschäftsidee daher oft im Nebenerwerb von den eigenen vier Wänden aus als Homeoffice betrieben.
Business im Homeoffice starten
Je nachdem, welchen Umfang und Außenwirkung die berufliche Tätigkeit entfaltet, gibt es verschiedene rechtliche Probleme. In diesem Beitrag von Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. soll es vorallem um die mietrechtlichen Herausforderungen gehen.
Food-Startups und Online-Shops müssen aufpassen
Zunächst sollte – bevor das Start-Up seine Tätigkeit aufnimmt, der Vermieter um Erlaubnis gefragt werden, um sich nicht des Vorwurf des vertragswidrigen Gebrauchs der Mietwohnung auszusetzen. Dabei kann bereits die geplante Tätigkeit beschrieben werden und mitgeteilt werden, ob mit Lärm, Gerüchen oder Publikumsverkehr zu rechnen ist. Insbesondere Food-StartUps, die aus der eigenen Wohnungsküche heraus starten oder Online-Shops, die im Bastelraum hergestellte Produkte verkaufen, sind hier also gefordert.
Dem Existenzgründern kann gekündigt werden
Wenn dies nicht getan wird, muss damit gerechnet werden, dass der Vermieter den Existenzgründer abmahnt und ggf. kündigt. Dies gilt generell auch, wenn nur einzelne Räume oder Raumteile für die Gründungsidee in Beschlag genommen werden.
Onlineshops auf Ebay oder Amazon müssen aufpassen
Der Vermieter wird zustimmen müssen, wenn die betriebliche Nutzung nicht nach außen hin in Erscheinung tritt und keine konkreten Störungen der Nachbarschaft zu erwarten sind. Gerade bei Online-Shops kommt es also auf den Einzelfall an, ob diese erlaubnispflichtig sind: Werden etwa fremde Waren zuhause gelagert, ist die Situation anders, als wenn nur eigene Waren verkauft werden. Einen Unterschied macht es auch, wenn häufig Paketzusteller ins Haus kommen oder weniger störend über eine Packstation operiert wird. Schließlich spielen auf Fragen, wie ob über eine starke Beeinflussung des gemeinschaftlichen Internetzugangs und ob ein Schild am Eingang samt Publikumsverkehr die Nachbarn stören können. Schließlich spielt auch eine Rolle, welche Gewinnhöhe Sie mit Ihrem Startup erzielen. Der Powerseller auf ebay oder Amazon wird also u.U. Schwierigkeiten bekommen.
Tipp vom Anwalt: Für den Umstand, dass keine vertragsmäßige Wohnnutzung mehr vorliegt, trägt der Vermieter die Beweislast.
Baurecht kann Ihrem business entgegenstehen
Im Umkehrschluss wird der Vermieter nicht zustimmen, wenn Störungen der Nachbarschaft nicht auszuschließen oder eine Beanspruchung der Mietwohnung durch die gewerbliche Tätigkeit zu erwarten ist. In diesem Zusammenhang wird auch das Baurecht eine wichtige Rolle spielen, denn je nachdem, ob sie sich in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) oder einem Reinen Wohngebiet (WR), einem Misch-, Dorf- oder sonstigem Gebiet befinden, gibt Ihnen die Baunutzungsverordnung verschiedene Schranken vor. Für freie Berufe, wie Journalisten, Dolmetscher, Ärzte ,Hebammen, Steuerberater, Auktionator oder Anwälte, sieht die Baunutzungsverordnung (BauNVO) Erleichterungen und Ausnahmen vor. Ebenfalls kann der Bebauungsplan Abweichendes regeln.
Tipp vom Anwalt: Daher empfiehlt sich eine Rückfrage beim Bauamt bzw. dem Bauordnungsamt, um Untersagungsverfügungen oder ein Bußgeld zu vermeiden. Zum Teil existieren auch Zweckentfremdungssatzungen.
Dem Vermieter einen Gewerbezuschlag zahlen
Im Übrigen sollte beim Mietzweck, wenn Sie sich vorstellen können ein eigenes business aus den eigenen Vier-Wänden zu starten, entsprechend angepaßt werde und maximal ein Erlaubnisvorbehalt für den Vermieter festgeschrieben werden. Im Umkehrschluss dürfte eine Klausel im Mietvertrag, die jegliche gewerbliche Tätigkeit generell untersagt nach Expertenmeinung unwirksam sein. Aus taktischen Gründen empfiehlt sich manchmal dem Vermieter einen Gewerbezuschlag zu zahlen.
Prostitution oder Thai-Massage – Arbeiten am Abend
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Ausübung der Prostitution in der eigenen Wohnung unzulässig. Bei Thai-Massage kommt es auf den Einzelfall an. Ebenfalls unübersichtlich ist die Situation bei Tagesmüttern. Unzulässig ist es auch die eigene Mietwohnung zur Bürogemeinschaft umzufunktionieren oder . Büroarbeiten am Abend oder am Wochenende sind hingegen klar zulässig. Ebenso gelegentliche Geschäftsessen zuhause und geschäftliche Telefonate. In der Rechtsprechung wurde auch schon schon die teilgewerbliche Nutzung als bewegungstherapeutische Praxis und astrologische Beratung als zulässig erachtet.
Situation in der WEG
Tipp vom Anwalt: Für Eigentumswohnungen, wo in der Teilungserklärung der Zweck als Wohnung festgeschrieben ist, ist eine teilgewerbliche Nutzung dennoch möglich. Um Streitigkeiten gleichwohl zu vermeiden, ist es sinnvoll in der Gemeinschaftsordnung Regelungen zur teilgewerblichen Nutzung und ggf. zur Verwalterzustimmung hierzu, festzulegen.
Hier geht es zu unserm Ressort Mietrecht: Mietrecht
Zinsen bei Anspruch auf Rentenbeitragsrückerstattung
Rentenbeitragserstattungsanspruch muss verzinst werden
Ein interessantes Urteil für den Geldbeutel für diejenigen, die zu Unrecht Rentenbeiträge geleistet haben, hat das Bundessozialgericht getroffen (Az.: B 10 LW 1/16 R). Diese Entscheidung stellt Ihnen der im Sozialrecht und Rentenrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. vor.
Bauer sucht Frau
Nach Heirat ist sie Bäuerin und für die Landwirtschaftliche Versorgungskasse damit beitragspflichtig. Zumindest bis über ihre Befreiung – sie war ja Beamtin – entschieden wurde. Als dies Ende September erfolgte, bekam die Lehrerin 1.800 € nebst Zinsen seit November zurückbezahlt.
Dagegen rebellierte die streitbare Beamtin, die ab der Beitragspflicht im Juni Zinsen wollte. Zurecht, wie das Bundessozialgericht nun urteilte. § 27 SGB I i.V.m. § 26 II, III SGB IV sehe nämlich einen Anspruch auf Verzinsung des Erstattungsanspruchs vor.
Verzinsung ab vollständiger Antragsstellung auf Befreiung
Weil die Normen eine besondere Ausprägung des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs seien, seien anders als im Zivilrecht Fragen der Fälligkeit, eines Verschuldens oder eines konkreten Schadens nicht zu stellen. Der Erstattungsanspruch sei vielmehr einfach nach Ablauf des Kalendermonats nach Eingang des vollständigen Erstattungsantrages zu erstatten. Damit gab das Bundessozialgericht seine vorherige jahrzehntelange Rechtsprechung auf!
Hier geht es zu unsere Ressorts Rentenrecht und Sozialrecht
Jobcenter verlangt vom Vermieter Miete zurück
Jobcenter mit Erstattungsanspruch gegen Vermieter
Dass das Jobcenter vor dem Sozialgericht verklagt wird, ist sicher der häufigere Fall. Dass das Jobcenter mal vor der Abteilung für Mietsachen am Amtsgericht klagt und versucht überbezahlte Miete vom Vermieter zurückzuverlangen daher eher ungewöhnlich. Der im Miet- und Hartz IV-Recht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. stellt Ihnen die ungewöhnliche Entscheidung vor (BGH vom 31.01.2018, Az.: VIII ZR 39/17).
Direktzahlung der Miete an Vermieter
Das Jobcenter hatte nach Beendigung des Mietvertrages durch seinen Kunden die Mieter versehentlich weiter an den Vermieter gezahlt. Der Mieter hatte es nach § 22 VII SGB II zuvor angewiesen den Vermieter direkt zu befriedigen. Genau von diesem forderte von diesem nun 860 € zurück. Der jedoch dachte aber gar nicht daran, sondern rechnete mit eigenen angeblichen Gegenforderungen gegen den “Hartzer” auf.
Keine Aufrechnung gegen das Jobcenter
Nachdem das Amtsgericht noch den Direktanspruch des Jobcenters gegen den Vermieter ablehnte, kam das Landgericht Kiel zur gegenteiligen Ansicht. Auf Gericht und auf hoher See ist man manchmal in Gottes Hand. Der Vermieter habe das Geld auch nicht behalten dürfen, weil er wissen musste, das er keinen Anspruch mehr darauf hat. Für den Gegenanspruch des Vermieters war das Jobcenter hingegen nicht der richtige Aufrechnungsgegner.
Hier geht es zu unserm Ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/mietrecht/09
Vermieter kann finanziell schwachen Mieter nicht loßwerden
Vermieter muss mit finanziell schwachem Mieter leben
Der an sich mieterfeindliche BGH hat eine Reihe mieterfreundlicher Urteile getroffen. Der im Mietrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter stellt Ihnen diese nach und nach vor.
Lebensgefährte trat in Mietvertrag ein
Nachdem die bisherige Mieterin gestorben war, trat deren sich in einer Ausbildung befindliche Lebensgefährte gem. § 563 BGB in den Mietvertrag ein. Der Vermieter versuche erfolglos den jungen Mann aus der Dreizimmerwohnung zu werfen (BGH v. 31.01.2018, Az.: VIII ZR 105/17). Der hatte sich nämlich recht geschickt verkauft und auf die Räumungsklage mit einer Widerklage gekontert auf Zustimmung eines Untermieters. Letztlich erfolgreich, denn seine Ideen, wie er die doch mit 720 € nicht gerade niedrige Bruttomiete aus seinem mageren Lehrlingsgehalt stemmen wollte, überzeuge die Richter. Denn neben dem Geld aus der Untermiete gäbe es die Möglichkeit Sozialleistungen, wie das Wohngeld oder kleine Geldgeschenke von Verwandten, um immer rechtzeitig und vollständig die Miete zu zahlen. Im Notfall könnte er auch eine Nebentätigkeit eingehen.
Wohngeld, Untervermietung oder Nebentätigkeit spülen Geld in die Tasche
Das überzeuge die BGH-Richter, die meinten, dass eine “gefährdet erscheinende finanzielle Leistungsfähigkeit des Mieters” objektiv feststehen müssen wenn der Vermieter deshalb gem. § 563 IV BGB außerordentlich kündigen wolle. Überhöhte Anforderungen an die Prognose der finanziellen Leistungsfähigkeit seien nicht zu stellen, d.h. wenn der finanziell schlecht aufgestellte Kläger ein schlüssiges Konzept präsentiert, wie er die Miete künftig aufbringen soll, dann muss der Vermieter dieses auch hinnehmen.
Tipp vom Anwalt: Wird Ihnen in so einem Fall gekündigt, präsentieren Sie dem Vermieter schriftlich ein schlüssiges Finanzierungskonzept und setzen sich zur Wehr.
Hier geht es zu unserem Ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/mietrecht/
EM-Rente wegen Depressionen und psychischen Erkrankungen
EM-Rente wegen Depressionen und psychischen Erkrankungen bekommen
Psychische Erkrankungen nehmen wegen des Stress im Arbeitsleben, Zeitdruck und einem immer intensiveren Konkurrenzkampf unter den Mitarbeitern zu. Bevor man deswegen eine Erwerbsminderungsrente gem. § 43 SGB VI wegen psychischen Erkrankungen erhält, müssen Betroffene eine Reihe von Hürden überwinden. In diesem Beitrag stellt Ihnen der im Sozialrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. einige Knackpunkte vor.
Lesen Sie hier mehr zu den versicherungsrechtlichen und medizinischen Voraussetzungen der EM-Rente: Tipp vom Anwalt: Drei Gründe, warum ihr Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird – und was sie dagegen tun können
Rentenrechtliche Relevanz erst nach ausgeschöpfter adäquater Behandlung
Eine Akuterkrankung reicht bei psychischen Erkrankungen noch nicht aus, um die EM-Rente zu bekommen. Es muss eine länger dauernde zeitliche Leistungseinschränkung von mehr als sechs Monaten gegeben sein (vgl. u.a. BSG vom 19.11.1997, Az.: 5 RJ 16/97). Psychische Erkrankungen sind daher grds. erst dann von rentenrechtlicher Relevanz, wenn alle medikamentösen, therapeutischen, ambulanten oder stationären Methoden aus eigener Kraft oder mit ärztlicher Hilfe erfolglos ausgeschöpft wurden (bea. aber die Entscheidung des SG Oldenburg vom 13.09.2017, S 81 R 54/16). Die Erwerbsfähigkeit kann jedoch weggefallen sein, wenn der Betroffene nicht mehr vermag seine Arbeitsstele aufzusuchen und der Leitungsträger eine Rehabilitationsleitung nicht verbindlich bewilligt hat.
Einzelne depressive Episoden reichen nicht
Einzelne mittelgradige oder schwere depressive Episoden reichen also in der Regel nicht. Ohnehin liegt die Feststellungslast hierfür beim Betroffenen, der bereits auch bei Krankengeldbezug aktiv Hilfsangebote vom Arzt oder der Krankenversicherung einfordern sollte. So scheiterte etwa ein 60-jähriger gelernter Schlosser und zuletzt als Kontrolleur von Flugzeuglagern tätig war, nach einem mehrwöchigen stationären Reha-Aufenthalt mit seinem Antrag auf EM-Rente. Wegen Depressionen, Asthma, einer Prostataerkrankung sowie Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen führte er ein ganzes Bündel von gesundheitlichen Beschwerden an (LSG München von 27.07.2016, Az.: L 19 R 395/14). Auch hier meinte das Gericht, dass nicht bewiesen worden sei, dass der Kläger „die Gesundheitsstörungen nicht durch zumutbare Willensanspannung aus eigener Kraft oder mit fremder Hilfe überwunden“ könne. Die vorgelegten Befunde, die eine „bewusstseinsnahe Einschränkung der Leistungsmotivation“ und eingeschränkte Stressbelastbarkeit belegten, überzeugten die Sozialrichter jedoch nicht im notwendigen Ausmaß.
Psychische Störung führt grundsätzlich nicht zu qualitativen Leistungseinschränkungen
Die beim Kläger vorhandene rezidivierende psychische Störung sei jedoch kein Dauerzustand und wohl auf äußere Umstände zurückzuführen, so dass keine quantitative Leistungsminderung im rentenrechtlichen Sinne vorliege. Qualitative Leistungsminderungen reichen in der Regel nicht. So erging es auch einem 58-jährigen Mann oder abgeschlossene Berufsausbildung, der zuletzt u.a. als Stapelfahrer tätig war, der zuletzt aber eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekam.
Lesen Sie hier mehr zur Altersrente für Schwerbehinderte: Mit Schwerbehindertenrente raus aus der Sozialhilfe
Für den Zeitraum zuvor forderte er erfolglos eine befristete EM-Rente (LSG Baden-Württemberg, Az.: L 5 R 4194/13). Er versuchte während des Verfahrens zu argumentieren, dass nunmehr zu seinen orthopädisch bedingten Einschränkungen nunmehr psychische Beeinträchtigungen hinzugekommen seien, wie heftige Schlafstörungen, Antriebsminderung und innere Unruhe im Sinne einer endogenen Depression. Das vorgelegte Gutachten wurde jedoch vom Sozialgericht regelrecht zerissen, weil die Leistungseinschätzung des Gutachters darauf abstelle, dass der Kläger der deutschen Sprache nicht mächtig sei, was aber aber keine gesundheitsbedingte Einschränkung darstellt. Seinen Vortrag, er leide an einer Demenz mit Orientierungsstörung wurde vom Gericht als nicht glaubhaft zurückgewiesen.
Ungünstige Prognose für Erwerbsfähigkeit hat hohe Hürden
Eine ungünstige Prognose bezüglich der Erwerbsfähigkeit komme danach erst in Betracht, wenn mehrere Faktoren zusammentreffen, wie eine mittelschwer bis schwer ausgeprägte depressive Symptomatik, ein qualifizierter Verlauf mit unvollständigen Remmissionen, erfolglos ambulant und stationär, leitliniengerechte durchgeführte Behandlungsversuche, einschließlich medikamentöser Phasenprophylaxe, eine ungünstige Krankheitsbewältigung, mangelnde soziale Unterstützung und psychische Komorbidität, lange Arbeitsunfähigkeitszeiten und eine erfolglose Rehabilitationsbehandlung, schrieben die Richter dem Kläger ins Stammbuch. Auch eine Wegeunfähigkeit liege beim Kläger nicht vor.
Ebenfalls ungünstig verlief die Klage eines 50-jährigen Steinmetzes, der nach 24 Jahren Berufstätigkeit wegen eines ganzen Bündels an gesundheitlichen Einschränkungen, von Bluthochdruck über Funktionsbehinderungen der Wirbelsäule über eine Alkoholkrankheit bis einem beidseitigen sulcus ulnaris-Syndrom EM-Rente beantragt hatte (BSG vom 06.08.2016, B 13 R 174/15 B und BayLSG vom 18.03.2015, Az.: L 19 R 956/11). Aber auch hier läge keine Summierung von ungewöhnlichen Einschränkungen vor zu der weitere Einschränkungen der Belastbarkeit hinzuträten, meinte das Landessozialgericht. Allein aus der langen Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit könne im Übrigen noch nicht auf das Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen zur EM-Rente geschlossen werden.
Hier geht es zu unserem Ressort Sozialrecht: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/sozialrecht/
Die Informationen hier sind keine Rechtsberatung, sondern dienen lediglich der Präsentation der Kanzlei Rechtsanwälte Niggl, Lamprecht und Kollegen. Die Rechtstipps geben nur einen allgemeinen Überblick über die Rechtslage und stellen keine Beratung für Ihren konkreten Einzelfall dar. Kurze rechtliche Fragen hierzu können telefonisch unter 09721/7934890 oder 093147085337 kostenfrei stellen.
Mit Schwerbehindertenrente raus aus der Sozialhilfe
Schwerbehindertenrente
Schwerbehinderte können bereits ab dem 63. Geburstag in Rente gehen. Jedoch ist es auch bereits gem. § 236a SGB VI ab dem 60. Lebensjahr möglich den Ruhestand zu genießen, wenn der Schwerbehinderte bereit ist im Gegenzug einen Abschlag bei der Vollrente hinzunehmen.
Auswirkungen auf Betriebsrente
Schwerbehinderte sollte darauf achten, ob eine betriebliche Vereinbarung oder andere Regelung existiert, dass die Betriebsrente zu mindern ist, wenn vorgezogen in den Rentenstand eingerichtet wird. Oft beträgt die Minderung 0,5 Prozent pro vorgezogenem Monat. Das LSG Rheinland Pfalz hat die Zulässigkeit solcher Regelungen ausdrücklich bejaht.
GdB muss mindestens 50 betragen
Neben einer 35-jährigen Wartezeit (hier zählen auch Zeiten der Schul- und Hochschulausbildung mit) braucht es einen Grad der Behinderung von mindestens 50. Gerade beim letzten Punkt gibt es immer wieder Streitigkeiten mit dem Versorgungsamt, das die vorhandene Behinderung bei Spielräumen nicht selten niedrigener einstuft, als es objektiv gerechtfertigt erscheint.
Tipp vom Anwalt: Lassen Sie sich in schwierigen Fällen bereits bei der Antragsstellung anwaltlich beraten. Im Falle eines Ablehnungsbescheides ist ein mit anwaltlicher Hilfe eingelegter Widerspruch sinnvoll.
Hier geht es zu unserem Ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/sozialrecht/
Mietminderung auch von Hartz IV-Empfängern
Mietminderung
KdU um Minderungsbetrag kürzen
Bei Direktzahlung Jobcenter über Mietmangel informieren
Minderung schlägt auf Nebenkosten durch
Befreiung von der Rentenversicherung nach § 6 I 1 Nr. 1 SGB VI bei typischen Tätigkeiten
Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung
Gute Nachricht für Ärzte für Humanmedizin, Apotheker, Architekten, Ingenieure und Rechtsanwälte: Berufstätige in Berufen, die wegen dem Vorhandensein einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe eigenen Versorgungskammer (berufsständische Versorgungseinrichtung) grundsätzlich von der Rentenversicherung befreit sind, sind auch dann befreit, wenn sie diesen Beruf nicht in dessen Kernbereichen nachgehen.
Industrietierärzte können befreit sein
Das Bundessozialgericht (Az.: B 5 RE 10/16 R) hat dies kürzlich für sogenannte Industrietierärzte entschieden, also Tierärzte, die im Produktmarketing, im wissenschaftlichen Technical Service, im wissenschaftlichen Außendienst, im Vertrieb, im Maketing oder in der Forschung und Entwicklung bzw. Arzneimittelzulassung arbeiten (also für Auftraggeber, wie veterinär- und humanpharmazeutische Unternehmen, Medizinproduktehersteller, Futtermittelhersteller, Lebensmittelindustrie und -forschung, Hersteller von Medizintechnik und Dienstleister für Tierärzte in Aufgabengebieten von Produktmanagement, über Technical Service, Wissenschaftlichen Außendienst, Verkauf von Produkten, Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle, Zulassung und Marketing).
Regelungen der berufsständischen Kammern
Demnach ist es nicht notwendig, dass der Berufstätige die typische Berufstätigkeit eines Tierarztes ausübt, sondern es genügt für die Befreiung von der Rentenversicherung, dass er nach dem weitergehenden Verständnis der jeweiligen Kammer (und deren Regelwerke) auch andere Tätigkeitsfelder bestellt.
Mehr als reiner Außendienstmitarbeit oder Pharmaberater
Im vorliegenden Fall war es für die Befreiung von der Rentenversicherung also ausreichend, dass der Kläger als Außendienstmitarbeiter in einem nichtselbständigen Arbeitsverhältnis in nicht mehr geringfügigen Umfang Tägigkeiten erbrachte, die über die bloße Informationstätigkeit zu bestimmten Arzneimitteln, wie sie ein klassischer Pharmaberater leistet, hinausging (z.B. teilweise Mithilfe bei Operationen etc.).
Tipp vom Anwalt: Bei Ablehnungen durch die Deutschen Rentenversicherung in der Vergangenheit, können diese Entscheidungen u.U. mit einem Antrag auf Überprüfung wieder aufgehoben werden. Beachten Sie auch, dass bei jedem Jobcenter die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung neu geprüft wird. Achten Sie deshalb darauf, dass im Arbeitsvertrag die Stellenbeschreibung so formuliert wird, dass klar wird, dass Sie die klassischen Tätigkeiten ihres Berufs ausüben.
Hier geht es zu unserem Ressort Rentenversicherungsrecht: Rentenrecht
Nur noch beschränkte Anrechenbarkeit von Betriebsrenten
Betriebsrentenstärkungsgesetz
In aller Munde ist momentan das Betriebsrentenstärkungsgesetz unter dem Schlagwort „Nahles-Rente“, das die betriebliche Altersversorgung attraktiver machen soll. Über den hohen bürokratischen Aufwand im Zusammenhang mit dem Gesetz wurde schon viel geschrieben.
Nahles-Rente
Neu ist seit diesem Jahr, dass die Betriebsrenten nicht mehr vollumfänglich auf die staatliche Hilfe zum Lebensunterhalt sowie auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung angerechnet werden, sondern nach § 82 Abs. 4 SGB XII Einkommen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge bis zu einem Freibetrag in Höhe von 100 Euro monatlich vollständig anrechnungsfrei bleibt. Über diesen Betrag hinausgehende Betriebsrenten bleiben zu 30 % anrechnungsfrei. Obergrenze der Anrechnungsfreiheit jedoch gemäß § 82 Abs. 4 Hs. 2 SGB XII die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1, d.h. 208 €.
Tipp vom Anwalt: Achten Sie darauf, dass dies in Ihrem Grundsicherungsbescheid Berücksichtigung findet und lassen Sie im Falle von Fehlern Widerspruch einlegen.
Riester-Renten, Rürup-Renten und zusätzliche Altersvorsorge
Einkommen aus zusätzlicher Altersvorsorge: Insbesondere Betriebsrenten, Riester-Renten und Rürup-Renten (Basisrenten).
Die Anrechnungsfreiheit gemäß § 82 IV SGB XII gilt übrigens nur bei Einkommen aus zusätzlicher Altersversorgung. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
– die Zahlungen müssen monatlich erfolgen.
– die Zahlungen müssen lebenslang sein.
– der Anspruch auf die Zahlungen muss vor Erreichen der Regelaltersgrenze gemäß §§ 35, 235 Abs. 2 Satz 2 SGB VI erworben worden sein.
– der Anspruch auf die Zahlungen muss auf freiwilliger Grundlage erworben worden sein.
– und die Zahlungen müssen dazu bestimmt und geeignet sein, die Einkommenssituation des Leistungsberechtigten zu verbessern
Hinweis: Die Grundzulage bei Sparverträgen für die Altersvorsorge wurde übrigens von 154 € auf 175 € erhöht, insbesondere um Riesterverträge attraktiver zu machen.
Hier geht es zu unserem Ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/rentenrecht/
Zum Hintergrund der sog. Nahles-Rente: Branchen mit Tarifvertrag können nun im sogenannten Sozialpartnermodell die Betriebsrente modifizieren, so dass der Arbeitgeber 15 % des Arbeitgeberzuschusses bei den Sozialversicherungsbeiträgen spart, wenn der Arbeitnehmer zugleich einer Umwandlung seines Entgeltes zustimmt. In diesem Zug entfällt die Subsidiärhaftung des Arbeitgebers und der Arbeitgeber erhält nur noch eine Zielrente.
Drei Tipps beim Abschluss eines Pflegevertrages
Pflegevertrag
Wer pflegebedürftig ist und auf die Hilfe von einem ambulanten Pflegedienst angewiesen, der bekommt in der Regel zunächst einen Pflegevertrag zur Unterschrift vorgelegt. Der im Pflegerecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. stellt Ihnen in diesem Beitrag drei wichtige Punkte vor, auf die sie achten sollten.
Private Zusatzkosten
Wenn die Kosten für Pflegeleistungen höher sind als der Anspruch aus der Pflegekasse, dann müssen Sie den Rest privat aus Ihrer Rente oder sonstigen Einkünften oder Ersparnissen leisten. Sie müssen kalkulieren, ob Sie sich das leisten können und ob ein mögliches Delta über die Sozialhilfe aufgefangen werden kann.
Tipp vom Anwalt: Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag machen! Der Vertrag sollte vorsehen, dass eine Anpassung des Leistungskatalog zu erfolgen hat, wenn die im Einzelfall erbrachten Pflegeleistungen sich absehbar dauerhaft ändern werden oder der Leistungsumfang für mindestens zwei Monate um mehr als 10 % des von der Pflegekasse übernommenen individuellen Sachleistungsbetrages geändert hat bzw. wenn sich die zwischen Pflegedienst und Pflegekasse vereinbarte Vergütung ändert. Auch dann sollte ein neuer Kostenvoranschlag erstellt werden.
Gute Pflegedienste beraten Sie außerdem auch bei der Auswahl und Beschaffung von Pflegehilfsmitteln und -materialien und informieren Sie über die relevanten Kostenträger. Akzeptieren Sie zudem nicht, wenn Klauseln enthalten sind, die dem Pflegedienst einseitig ein Recht zur Preiserhöhung geben auch in Bezug auf Investitionskosten. Über die Leistungen sollte zudem monatlich abgerechnet werden und Vorauszahlungen nicht verlangt werden dürfen.
Lesen Sie hier mehr zu den Investitionskosten: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/2018/03/20/schmu-bei-den-investitionskosten-fuer-das-pflegeheim/
Leistungsbeschreibungen oder Zeitkontigente
Werden im Pflegevertrag keine genauen Leistungskomplexe festgelegt, sondern nur nur schlagwortartige Bezeichnungen, wie „Grundpflege“ oder „Pflegeleistungen nach § 36 SGB XI“ verwendet, ist der Vertrag zu intransparent und sie wissen nicht welche Leistung Sie für Ihr Entgelt erhalten. Zudem sollte abgeklärt werden, ob auch Kooperationspartner des Pflegedienstes die Leistung erbringen dürfen. Es ist aber durchaus auch die Vereinbarung von Zeitkontigenten akzeptabel. Sie sollten auch im Vorfeld abklären, ob der Pflegedienst alle Leistungen anbieten bzw. vermitteln kann, die Sie evtl. mal benötigen (z.B. Intensivbetreuung, Beatmung etc.) und ob ausreichend gut qualifiziertes Programm vorgehalten wird. Gute Pflegedienste übernehmen auch die Aufsicht über die Medikamentenversorgung, inklusive der Bereithaltung neuer Rezepte sowie deren Einlösung. Wenn der
Tipp vom Anwalt: Immer mehr Pflegedienste lassen sich extern zertifizieren oder Qualitätssiegel verleihen. Eine Nachfrage bei der Pflegekasse, Ihrem Hausarzt oder bei den regionalen Beratungsstellen (z.B. Pflegestützpunkte) kann Ihnen wichtige Information über den Pflegedienst liefern.
Ruhen des Pflegevertrages und Kündigungsfristen
Eine Kündigungsfrist von unter zwei Wochen seitens des Pflegedienstes ist unangemessen kurz, weil er seinen Sicherstellungsauftrag zu beachten hat. Der Pflegende hat aber das Recht haben jederzeit und ohne Angaben von Gründen fristlos zu kündigen. Zudem kann vereinbart werden, dass der Vertrag durch Tod des Leistungsnehmers automatisch endet. Sinnvoll ist, ein Ruhen des Vertrages zu vereinbaren bei vorübergehendem stationären Aufenthalt des Pflegebedürftigen im Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtungen sowie in der Kurzzeitpflege.
Update: Eine für Pflegebedürftige positive, wenn auch überraschende, Entscheidung hat der BGH kürzlich getroffen (BGH vom 04.10.2018, Az.: III ZR 292/17).
Ein an Mutiple Sklerose erkrankter Mann hatte seinen Pflegeheimplatz zum Monatsende gekündigt, war aber bereits schon in der Monatsmitte in ein anderes Pflegeheim umgezogen. Das alte Pflegeheim zog von der Pflegekasse für den ganzen Monat 1.493,03 € ein, was bedeutete, dass der Kläger wohl Pflegestufe 4 hatte, was aktuell Pflegegrad 5 nach der Überleitung wäre.
Dem Pflegebedürftigen gelang es durch alle Instanzen seinen bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Rückerstattung dieses Geldes erfolgreich zu verteidigen. Denn der Grundsatz der taggenauen Abrechnung gem. § 87a I 2 SGB XI .V.m. § 15 WBVG lässt die Zahlungspflicht des Pflegebedürftigen entfallen, wenn er aus dem Heim entlassen wird oder stirbt. Nach Ansicht der Richter am Bundesgerichtshof steht einer Entlassung der Umzug beziehungsweise die Verlegung in ein anderes Pflegeheim gleich. Bei einem nicht nur vorübergehenden Verlassen des Heimes müsste dem Pflegebedürftigen nämlich kein Platz freigehalten werden. Pflegebedürftige, die Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, sollten darüber hinaus nach dem Willen des Gesetzgebers in einer solchen Situation nicht doppelt in Anspruch genommen werden.
Tipp vom Anwalt: Pflegeheime müssen dieses wirtschaftliche Risiko im Rahmen ihrer Auslastungskalkulation sowie durch Wagnis- und Risikozuschläge berücksichtigen. Gegebenenfalls müssen Pflegesätze daher nach oben angepasst werden. Abweichende Regelungen im Heimvertrag sind jedenfalls nach § 87a I S. 4 SGB XI nichtig, so dass man dieses Risiko vertragsgestalterisch schwer wird abdämpfen können. Lassen Sie sich hier im Einzelfall jedenfalls umfassend anwaltlich beraten.
Weitere Fragen: richter(at)anwaltskanzlei-wue.de
hier geht es zu unserem Ressort https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/pflegerecht/
Modernisierung? aber bitte nur in Maßen!
Modernisierungen sind nicht grenzenlos zu dulden
In diesem Fall hatte eine Entwicklungsgesellschaft 13 Reihenhäuser erworben, die sie umfangreich in über 13 Wochen umgestalten wollte. Am Ende sollte die Miete sich fast verfünffachen auf 2.149,99 €! Unser im Mietrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter stellt die interessante Entscheidung vor.
BGH vereinte Duldungspflicht der Mieter für
So plante die Entwicklungsgesellschaft neben umfangreichen Wärmedämmungsmaßnahmen, die Ertüchtigung der Elektroinstallation, den EInbau neue sanitärer Einrichtungen und vorallem die Veränderung des Zuschnittes der Wohnungen durch Entfernung von Wänden und den Einbau einer neuen Treppe. Dazu kam ein Abriss eines Nebengebäudes und der Einbau einer Gasetagenheizung. Das war dann sogar dem grundsätzlich vermieterfreundlichen BGH zuviel (BGH vom 21.11.2017, Az.: VIII ZR 28/17).
Tipp vom Anwalt: Immer wieder sehen sich Mieter großen Mieterhöhungsverlangen Ihrer Vermieter nach Modernisierungen ihrer Wohnung ausgesetzt. Bis zu 11% der Gesamtkosten jährlich, nunmehr aktuell 8%, können Vermieter an sie weiterreichen. Der Gesetzgeber hat eine neue Kappungsgrenze geschaffen, so dass innerhalb von sechs Jahren die Miete pro Quadratmeter nur um 3€ ansteigen darf, im Einzelfall sogar weniger.
Die Entwicklungsgesellschaft scheiterte mit ihrem Gesamtkonzept der Modernisierung auf voller Linie, weil die Anwälte, ob bewusst oder unbewusst, es versäumt hatten, wenigstens die als Instandhaltungsmaßnahmen von den Mietern zu duldenden Arbeiten mittels Hilfsanträgen geltend zu machen.
Lesen sie hier mehr
Tipp vom Anwalt: Nach dem MietAnpG gilt bei kleinen Modernisierungen bis 10.000 € ein vereinfachtes Berechnungsverfahren, wonach Vermieter pauschal 30 % der Kosten abziehen können und den Rest als Modernisierungskosten umlegen!
Veränderung von Zuschnitt und Grundriss veränderte Mietsache weitgehend
Tipp vom Anwalt: Bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, deren Zustimmung der Mieter verweigert, das Gesamtpaket prozessual in die verschiedenen Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen aufsplitten.
Eine zu duldende Modernisierung sahen die Richter des BGH in dem Gesamtpaket nicht, weil es zwar über die bloße Erhaltung des bisherigen Zustandes hinausgeht, jedoch die Mietsache aufgrund des veränderten Zuschnitts und des Grundrisses so verändert, dass etwas Neues entsteht.
Lesen Sie hier mehr zu Ihren Rechten
Auch aus § 242 BGB leiteten die Richter am Bundesgerichtshof keine Duldungspflicht des Mieters ab.
Hier geht es zu unserem Ressort Mietrecht
Die Gewinninteressen des Vermieters haben Grenzen. Lesen Sie diesen interessanten Fall: Das interessante Urteil: Gewinnoptimierung sticht nicht Mieterrech
Betreuungsgeld auf Hartz IV anrechenfrei
Betreuungsgeld nach SG Bayreuth anrechenfrei
Das Betreuungsgeld in Bayern, die sogenannte “Herdprämie”, die Eltern als Belohnung dafür gezahlt wird, dass sie ihr Kind ab dem 15. Lebensmonat nicht in die Kita schicken, sondern zuhause erziehen ist anrechnungsfrei.
Betreuungsgeld gibt es für maximal 22 Monate
Das Bayerische Betreuungsgeld in Höhe von 150 €/Kind kann grundsätzlich ab Beginn des 15. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Es endet spätestens mit Vollendung des 36. Lebensmonats. Bayerisches Betreuungsgeld kann aber auch ausnahmsweise vor dem 15. Lebensmonat beansprucht werden. Voraussetzung ist, dass die Eltern die maximale Bezugszeit des Elterngeldes bereits ausgeschöpft haben. Es wird maximal für 22 Monate, längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs gewährt. Dies gilt auch bei Adoptionen beziehungsweise Kindern in Adoptionspflege.
Kein Einkommen i.S.v. § 11a III SGB II
Dass es anrechenfrei ist hat zumindest das SG Bayreuth am 28.11.2017 geurteilt. Die Entscheidung ist nach derzeitiger Kenntnis noch nicht rechtskräftig. Eine Mutter hatte sich dagegen gewehrt, dass ihr die 150 Euro auf die Hartz IV-Regelleistung angerechnet werden. Zurecht, wie das Sozialgericht unter Vorsitz vom ehrwürdigen Sozialrichter Dr. Mayer-Metzner urteilte (Az.: S 4 AS 363/17)
Das Betreuungsgeld sei nämlich nicht nach § 11a III S. 1 SGB II anrechenbar, weil das Betreuungsgeld einen Schonraum für Familien mit Kleinkindern schaffen und nicht als Einkommen i.S.d. SGB II zählen solle, was den Lebensunterhalt sichert. Dies ergibt sich so aus der amtlichen Begründung zum BayBtGG (LT-Drs. 17/9114).
Die häufigsten Fehler in Hartz IV-Bescheiden: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/2017/09/19/die-fuenf-haeufigsten-fehler-in-hartz-iv-bescheiden/
Widerspruch einlegen lassen
Wenn Ihr Jobcenter dennoch das Betreuungsgeld anrechnet, dann lassen Sie Widerspruch einlegen und prüfen Sie ggf. einen Überprüfungsantrag i.S.d. § 44 SGB X.
Mehr Fragen? kurze rechtliche Fragen werden kostenfrei Beantwortet: richter(at)anwaltskanzlei-wue.de
Hier geht es zu unserem Ressort Hartz IV: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/hartz-iv/
Regress gegen Frachtführer bei zollrechtlichen Schwierigkeiten
Hinweispflichten nur für spezialisierte Zollspedition
Heute stellen wir Ihnen denn Fall vor, bei dem ein Frachtführer wegen zollrechtlichen Schwierigkeiten Regressansprüchen des Absenders nach Verlust des Transportgutes ausgesetzt war:
Multimodaltransport über zwei Kontinente
Im Mai 2012 sollte zum Festkostenpreis ein Transport von 35 gebrauchten Pkws von Haar bei München nach Misurata in Libyen durch den beklagten Spediteur erfolgen. Der beklagte Spediteur beauftragte dann einen Unterfrachtführer mit dem (See-)Transport. Die Ladung wurde von einem Fixkostenspediteur übernommen und in sieben Containern zunächst per Bahnfracht nach Triest (Italien) transportiert. Die Ladung sollte von dort eingeschifft werden und eine Woche später in Misurata (lbyen) eintreffen.
Einfuhrbedingungen nicht beachtet
Dazu kam es nicht: Der Unterfrachtführer teilte dem beklagten Spediteur mit, er habe soeben erfahren, dass aufgrund der Einfuhrbestimmungen in Libyen gebrauchte Pkws bei ihrer Einfuhr nicht älter als vier Jahre sein dürften. Er bitte daher um Mitteilung des genauen Alters der zu befördernden Fahrzeuge. Soweit diese älter als vier Jahre seien, müsste er die Buchung ablehnen. In dem nachfolgenden umfangreichen E-Mail-Verkehr zwischen dem Unterfrachtführer und dem beklagten Spediteur bestand Letzterer weiterhin auf einer Auslieferung des Transportgutes nach Libyen.
Transportgut ging verloren
Bei einem planmäßigen (See-)Zwischenstopp im süditalienischen Hafen Gioia Tauro wurden die Container aus dem Schiff entladen.Daraufhin bat der Unterfrachtführer weiterhin um Angaben zum Alter der Pkws. Der beklagte Spediteur äußerte hierauf, dass er über keine entsprechende Information verfüge. Der weitere Verbleib des Transportgutes nach dem Entladen ist unklar. Es ist weder in Libyen angekommen,noch zum Absender zurückgeliefert worden.
Klage gegen Spedition auf Rückzahlung Fracht und Zölle
Mit seiner Klage hat der Absender den Spediteur unter anderem auf Rückzahlung der an ihn geleisteten Frachtpauschale und der entrichteten Zölle sowie auf Ersatz vorgerichtlicher Kosten (Anwalt) in Anspruch genommen. Die beklagte Spedition hingegen wollte neben der Abweisung der Klage widerklagend, dass der Absender verurteilt würde, sie von allen Ansprüchen freizustellen, die der Unterfrachtführer aus dem Unterfrachtvertrag gegen ihn wegen der fehlenden Importfähigkeit der geladenen Fahrzeuge hat.
Schadensersatz wegen Ladungsverlust gegen Frachtführer
Der BGH schließlich, gab dem Anspruch des Absenders auf Schadensersatz gegen den Fixkostenspediteur statt, da der Schaden im Obhutszeitraum von diesem entstanden wäre. Dafür spräche vorliegend gemäß dem BGH:
→ Wird nach Übernahme des Gutes erkennbar, dass die Ablieferung nicht vertragsgemäß durchgeführt werden kann, so hat der Frachtführer Weisungen des Absenders einzuholen. Kann der Frachtführer Weisungen innerhalb angemessener Zeit jedoch nicht erlangen, so hat er die Maßnahmen zu ergreifen, die im Interesse des verfügungsberechtigten Absenders die Besten zu seien scheinen. Er kann etwa das Gut entladen und verwahren, es für Rechnung des Absenders einem Dritten zur Verwahrung anvertrauen oder es zurückbefördern.
→ Nach dem Entladen des Gutes gilt die Beförderung gemäß § 419 Abs. 3 Satz 5 HGB als beendet und damit endet auch der Frachtvertrag. Wegen eines später eintretenden Verlusts des Gutes haftet der Frachtführer daher grds. nicht mehr nach den Regelungen des Frachtrechts. Sofern das Gut aber weiter in seiner Obhut bleibt, bestimmt sich seine Haftung entweder nach den Vorschriften über die Verwahrung gemäß §§ 688 ff. BGB oder wenn eine Einlagerung erfolgt, nach den Bestimmungen über das Lagergeschäft gemäß §§ 467 ff. HGB. Vorliegend bleibt es jedoch bei der Haftung nach Seefrachtrecht, denn das Entladen des Transportgutes durch die Unterfrachtführerin hatte nicht zur Beendigung der Beförderung geführt und die Obhut des beklagten Spediteurs wurde nicht beendet.
Weisungen beim Absender sind einzuholen
Abweichendes gelte nur dann, wenn die Beendigung der Beförderung im Unterfrachtverhältnis dem Hauptfrachtführer zuzurechnen wäre – etwa weil sie von ihm veranlasst oder mit ihm abgestimmt ist und im Hauptfrachtverhältnis der Frachtführer ebenfalls erfolglos versucht hat Weisungen beim Absender einzuholen aber sie nicht erlangt hat.Freilich kann die Frage, ob diese Voraussetzungen vorliegen im jeweiligen
Vertragsverhältnis andsers zu beurteilen sein als im Hauptfrachtverhältnis. Dementsprechend führt das Entladen des Gutes durch den Unterfrachtführer auch nicht notwendig zu einer Beendigung der Beförderung im Hauptfrachtverhältnis. Denn wenn der vom Hauptfrachtführer beauftragte Unterfrachtführer die von ihm begonnene Beförderung beendet, steht es dem Hauptfrachtführer grundsätzlich frei, die Beförderung selbst oder durch einen anderen Unterfrachtführer fortzusetzen. Die Obhut des Spediteurs endete daher nicht.
Keine Haftung nach Seetransportrecht
Der nach dem Entladen vom Schiff eingetretene Verlust des Transportgutes ist nach Seetransporthaftungsrecht zu bestimmen:
→ Die Haftung nach (See-)Transportrecht kommt bei mehreren Ursachen – innerhalb und außerhalb des Obhutszeitraums – jedoch nicht in Betracht, wenn jede dieser Ursachen den eingetretenen Schaden allein verursacht hätte, weil der Schaden dann weder insgesamt noch teilweise einer bestimmten Teilstrecke zugeordnet werden kann. Das war – wie vorstehend – jedoch nicht der Fall.
–> Es kam aber eine Haftung nach Lagerrecht in Straßengütertransportrecht sicher in Betracht.
Anpruch wegen Mitverschulden des Absenders nicht entfallen
Die Haftung des Spediteurs könne trotz Mitverschuldens des Absenders nicht völlig ausgeschlossen sein, so die Richter, denn primäre Schadensursache war der Verlust des Gutes durch den Frachtführer, nicht etwa ein fehlender Hinweis des Absenders. Daher liegt höchstens eine Mitverursachung des Schadens durch den Absender vor, wenn der Schaden mit darauf beruht, dass der Absender dem Frachtführer zu dem Gut nicht die Angaben gemacht hat, die dieser für die Durchführung der Beförderung benötigte. Dazu zählen unterlassene Angaben zu Umständen, die am Bestimmungsort zu Schwierigkeiten, wie einer behördlichen Inanspruchnahme, führen können, wenn diese Umstände für den Frachtführer nicht offenkundig sind. Je nachdem, ob die beklagte Spedition als z.B. reiner Hausspediteur oder als spezialisierte Zollspedition auftritt, können hier daher verschiedene Maßstäbe anzulegen sein.
Hinweispflichten für spezialisierte Zollspedition
Im letzteren Fall müsste der Spediteur nämlich durchaus einen Warnhinweis geben. Neben der überwiegenden bis gar keiner Haftung des Spediteurs sind daher viele Ergebnisse denkbar.
Schulungen für Mitarbeiter von Frachtführern und Speditionen
Praxistippr: Schulen sie ihre Mitarbeiter regelmäßig auch im Zollrecht und lassen Sie diese dokumentieren, wenn sie dem Absender einen Warnhinweis gegeben haben. Lassen sie den Absender dem Empfang des Warnhinweises zur Sicherheit bestätigen!
hier geht es zu unserem Ressort Transport- und Speditionsrecht:
Standgeld
Standgeld
Backgroundcheck Standgeld: Der Empfänger schuldet grundsätzlich zur Fracht ein Standgeld wegen Überschreitung der Entladezeit, wenn der Absender das Entladen schuldet und der Frachtführer von der Verzögerung Mitteilung gemacht hat. Oder wenn das Standgeld vertraglich vereinbart wurde.
Rechtliche Lage in den CMR-Staaten unterschiedlich
Der Standgeldanspruch entfällt, jedoch wenn die Zeitüberschreitung in den Verantwortungsbereich des Absenders fällt. Dies ist etwa nicht der Fall, wenn der Frachtführer die Verladung und Entladung übernommen hat und er sich deshalb Defekte seiner Ladehilfsmittel, den Krankenstand oder Streik seiner Arbeitnehmer zurechnen lassen muss. Beim Auftreten von neutralen Verzögerungen, wie etwa einer rechtswidrigen Beschlagnahme des LKWs an der Grenze, ist die Rechtslage in den verschiedenen CMR-Staaten unterschiedlich (siehe unten).
Angemessenheit des Standgeldes
Die Angemessenheit der Vergütung bemisst sich dann grds. an den am Ort der Entladezeit üblichen Sätze, wenn die angemessene Vergütung nicht aus dem Mittel von Fahrerlohn zuzüglich Spesen und Auslösungen sowie etwaigen betriebsabhängigen Kosten ermittelt wird. Von 33 Euro/Stunde (Amtsgericht Bonn) über 66 Euro/Stunde (Amtsgericht Villingen) bis 60 Euro/Stunde (Amtsgericht Mannheim) reichen die Sätze, die deutsche Gerichte pauschal als angemessen akzeptieren. Der österreichische OGH hat kürzlich sogar 200 Euro als Standgeld für angemessen erachtet.
Standgeld und Ladungssicherung
Vorsicht bei der Ladungssicherung: Da dem Gesetz nach der Absender die beförderungssichere Verladung schuldet, fallen Verzögerungen in die Sphäre des Frachtführers, wenn mangels ausreichender Weisungen des Frachtführers betriebsunsicher verladen wird und nachträglich eine betriebssichere Ladung vorgenommen werden muss. Hier entfällt der Standgeldanspruch!
Widersprechende Standgeldregeln in AGBs
Fall des AG Mannheim: Der Frachtführer führte für den Absender einen Transport innerhalb Deutschlands durch. Der Auftrag kann zunächst telefonisch zu Stande, danach übersandte die Absenderin per Mail ihren Transportauftrag, den der Frachtführer schriftlich bestätigte In den gegenseitig übersandten AGBs befanden sich widersprechende Bedingungen zur Zahlung von Standgeld. Als Ladetermin wurde ein Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr festgelegt. Gleichwohl wurde erst um 14:45 Uhr mit der Beladung begonnen und diese um 15:10 Uhr beendet worden, obwohl der Frachtführer bereits vor 12:00 Uhr zum Ladeort gekommen war und sich ladebereit gemeldet hatte. Für die entstandene Verzögerung möchte der Frachtführer ein Standgeld von 30 Euro/halbe Stunde vom Empfänger haben.
AG Mannheim entschied zugunsten des Frachtführers
Zurecht, wie das Gericht unter Verweis auf die Standgeldvereinbarung und § 412 III HGB feststellte, weil der Frachtführer zu Beginn des Zeitintervalls ladebereit an der Verladestelle bereitstand. Auf diesen Zeitpunkt und nicht das Ende des Zeitintervalls sei abzustellen, um einen geordneten Ladebetrieb und Frachtumschlag sicherzustellen. Ansonsten müsste der Frachtführer ja auch bei großzügig bemessenen Ladeterminen – solche können mehrere Stunden erreichen oder auch nur den Tag angeben – erst nach stundenlangem Zuwarten mit der Verladung beginnen.
Vertragliche Regeln zum Standgeld treffen
Praxishinweis: Vertraglich sollten die Voraussetzungen und die Höhe von Standgeldern vereinbart werden, denn das deutsche Recht trifft mit § 421 III HGB nur eine grundsätzliche Regelung. Zum Teil ging die Praxis bisher sogar davon aus, dass pauschal maximal zwei Stunden Wartzezeit für die Beladung und maximal zwei Stunden für die Entladung bei Komplettladungen von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 40 Tonnen ein angemessener Zeitraum seien und zu keinem Standgeldanspruch führen. Daher: Gestalten Sie die Rechtslage für sich um!
CMR kennt originären Standgeldanspruch nicht
Vorsicht: Im internationalen Straßengüterverkehr sieht die CMR zwar einen Kostenersatzanspruch für reine Verladekosten vor, nicht aber für das Standgeld (str.). Daher sollten Sie im internationalen Straßengüterverkehr immer eine Standgeldvereinbarung treffen, da in den CMR-Staaten nur teilweise ein Handelsbrauch dahingehend besteht, dass Standgeld gezahlt werden muss.
Transporte nach Österreich
Dazu eine interessante Entscheidung des OGH Wiens vom 17.04.2013: Der Empfänger hatte den Frachtführer mit dem Transport von 20.000 kg gebrauchten Stahlrohren von Panama über Kiew nach Österreich zu Frachtkosten von 1.350,00 Euro. beauftragt. Frachtführer und Empfänger kannten sich, da diese vor über vier Jahren regelmäßig bei Rußlandtransporten zusammengearbeitet hatten (damals ca. 500 LKWLadungen/Jahr). Aus irgendwelchen Gründen endete die Zusammenarbeit. In den AGBs des Frachtführers war seinerzeit folgende Klausel enthalten: „Die Frachtrate versteht sich zuzüglich der der vereinbarten Kosten für Zusatzleistungen und zuzüglich der üblichen Nebenspesen. Standgeld in GUS, TR, Kaukasus-Republiken bzw. Orientländer: 24 Stunden frei für Be-/Entladung (inkl. Zollformalitäten) in Westeuropa, 48 Stunden frei für Be-/Endtladung (inkl. Zollformalitäten) in GUS, TR, KaukasusRepubliken bzw. Orientländern. Darüber hinaus verreichnen wir 420 Euro pro angefangene 24 Stunden.“
Beschlagnahme der Fracht durch Zoll
Über Frachtpreise und Bedingungen wurde zwischen Empfänger und Frachtführer nicht gesprochen. In seiner Auftragsbestätigung verwies der Frachtführer aber auf seine AGBs, denen der Empfänger nicht widersprach. Es kam dann zum erwarteten Chaos: An der ukrainischen Grenze wurde der Sattelschlepper mit den Stahlrohren vom Zoll fünf Monate lang zu Unrecht beschlagnahmt, weil die Grenzer die Ladung als Abfall eingestuft hatten. Erst auf den Beschluss eines ungarischen Verwaltungsgerichts gab die Staatsanwaltschaft die Ladung frei. Daraufhin forderte der Frachtführer von dem Empfänger ein Standgeld für 167 Tage in Höhe von 33.400 Euro und bekam von den österreichischen Gerichten Recht.
Verzögerung während Beförderung
Warum? Nach österreichischer Rechtsauffassung gehen neutrale Ursachen, wie hier die rechtswidrige Beschlagnahme durch den Zoll, nicht zulasten des Frachtführers. In Deutschland steht zu dieser Frage eine höchstrichterliche Entscheidung noch aus. Anders als nach deutschem Verständnis kann hier auch ein Standgeldanspruch bei Verzögerungen während der Beförderung bis zum Zeitpunkt der Ablieferung entstehen, da es nach der bisherigen Rechslage in der Alpenrepublik keine Sonderregelung im dortigen HGB, wie bei uns in Deutschland gibt. Die vertragliche Standgeldvereinbarung schließlich sah der österreichische Gerichtshof dann durch den Verweis in der Auftragsbestätigung und die zwar zurückliegende, aber Jahre lang andauernde Geschäftsbeziehung zwischen Empfänger und Frachtführer als wirksam vereinbart an. Auch inhaltlich sah er die Klausel als voll wirksam an.
Vorsicht vor unwirksamen Klauseln
Praxistipp: Daher treffen Sie als Frachtführer Standgeldvereinbarungen. Lassen Sie sich dabei von einem Rechtsanwalt beraten, da Klauseln, wie „24 Stunden sind zur Be- bzw. Entladung standgeldfrei“ bereits von deutschen Gerichten als unwirksam erachtet worden sind. Auch die Abrede zwischen Absender und Frachtführer, dass die Ablieferung „frachtfrei“ zu erfolgen habe, führt nach Ansicht des AG Villingen-Schwennigen nicht dazu, dass der Standgeldanspruch gegen de Empfänger entfiele.
Hier geht es zu unserem Ressort Transport- und Speditionsrecht: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/transport-und-speditionsrecht/
Geringverdiener mit Kindern können Kinderzuschlag beantragen
Mit Wohngeld und Kinderzuschlag raus aus Hartz IV
Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit sind zuständig
Mietkosten werden vom Einkommen abgezogen
Neben Kinderzuschlag noch auf das Bildungspaket zugreifen
Eingliederungshilfe
Eingliederungshilfe
Auf über 895.000 Behinderte ist die Zahl derer angestiegen, die Eingliederungshilfe beziehen. Mehr als 17 Milliarden Euro lässt sich der Staat die Maßnahmen, die drohende Behinderungen abwenden, eine vorhandene oder deren Folgen mindern bzw. einen Beitrag zur Eingliederung in die Gesellschaft bringen sollen, kosten. Der im Sozialrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur stellt Ihnen in diesem Beitrag die sechs wichtigsten Maßnahmen der Eingliederungshilfe i.S.v § 54 SGB XII – bleibt hier zunächst trotz Bundesteilhabegesetz – vor.
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (vgl. § 54 SGB XII i.V.m. § 42 ff. SGB IX)
Die medizinische Rehabilitation ist ein Teilbereich der Reha, die ambulant oder bis zu drei Wochen stationär („Kur“) erbracht werden kann. Zu dem doch recht umfangreichen Leistungskatalog zählen u.a. die Anschlussheilbehandlung (AHB) nach abgeschlossener Akutphase eines Krankenhausaufenthaltes im Falle einer in der AHB-Indikationsliste enthaltener Diagnose (z.B diabetes mellitus, Gefäßkrankheiten oder Krankheiten des Herzens oder des Kreislaufsystems), die in der Regel dreiwöchige onkologische Nachsorge, z.B. in Form einer Nach- und Festigungskur bei Krebserkrankungen oder die geriatrische Reha für ältere Menschen. Kostenträger ist hier meist die Krankenkasse.
Lesen Sie hier mehr zum richtigen Umgang mit Ihrer Krankenkasse: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/2017/09/21/tipps-fuer-den-richtigen-umgang-mit-ihrer-krankenversicherung/
Tipp: Im Anschluss an eine medizinische Rehamaßnahme kann es sinnvoll sein eine zunächst stufenweise Wiedereingliederung an die volle Arbeitsbelastung durchzuführen (sog. Hamburger Modell). Dazu müssen allerdings Patient und Arzt zusammen einen sogenannten „Wiedereingliederungsplan“ erstellen und die nötigen Anträge beim zuständigen Sozialversicherungsträger stellen.
Leistungen zur beruflichen Reha (§ 54 SGB XII i.V.m. § 49 SGB IX)
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) werden z.B. als Zuschüsse an den Arbeitgeber durch die Arbeitsagentur, den Rentenversicherungsträger oder die Berufsgenossenschaft erbracht. Weitere Leistungen sind:
- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes sowie zur Förderung der Arbeitsaufnahme, beispielsweise durch die Kostenübernahme für Arbeitsausrüstung, Hilfsmittel oder technische Arbeitshilfen, aber auch Leistungen zur Berufsfindung und Arbeitserprobung oder die sog. Kraftfahrzeughilfe (bis zu 9.500 € bei einem Nettoeinkommen von 1,190 € zur Beschaffung eine Fahrzeuges zzgl. behinderungsbedingte Zusatzausstattung)
- Berufsvorbereitung, wie u.a. die blindentechnische Grundausbildung
- berufliche Bildung zur Anpassung an den Beruf, Ausbildung und Weiterbildung
- Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Eingangsverfahren oder im Bildungsbereich
- Übernahme weiterer Kosten, z.B. für Lernmittel oder Arbeitskleidung
- Zuschüsse an den Arbeitgeber (Achtung: in Bayern nunmehr bis zu 1.428 €).
Achtung: Neues Urteil des LSG Baden-Württemberg
Nach dem LGS Baden-Württemberg vom 18.09.2017 (Az.: L 7 SO 774/16) müssen Sozialhilfeträger bei längerer Krankheit eines behinderten Menschen die Beschäftigung in einer WfbM nicht mehr finanziell fördern, weil er als “nicht werkstattfähig” gelte, wenn er aufgrund der Krankheit nicht mehr ein “Mindestmaß an Arbeitsleitung” erbringen könne.
Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (§54SGB XII i.V.m § 76 SGB IX)
Die Höhe der Leistung hängt immer ab von der Art und Schwere der Behinderung sowie den vorhandenen Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Eingliederungshilfe kann man u.U. auch als Persönliches Budget erhalten.
Lesen Sie hier mehr zum Persönlichen Budget: Aufgemerkt: Bundesteilhabegesetz bringt Bewegung ins Persönliche Budget
Über zahlreiche Fallkonstellationen haben die Sozialgericht in den letzten Jahren zu entscheiden gehabt:
- Tagesbetreuung für Senior nach Vollendung 65. Lebensjahr (SG Heilbronn vom 30.04.2013, Az.: 3884/11)
- Kosten für behindertengerechten Umbau des Fahrzeugs (SG Karlsruhe vom 14.08.2015, Az.: S 1 SO 4269/14)
- Kosten für PC-Schulung (LSG Bayern, Az.: L 18 SO 6/12)
Angemessene Schulbildung, Ausbildung und Teilhabe am Arbeitsplatz
- Die Haupthilfe für angemessen Schuldbildung besteht in der Übernahme der Kosten der zusätzlichen Betreuung in der Schule (Integrationshelfer)
–> vgl. zu Schulbegleitern (BSG vom 09.12.2016, Az.: B 8 SO 8/15 R)
- Für arbeitende Behinderte werden zahlreiche Dienst-, Sach- und Geldleistungen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, zur Aktivierung und zur beruflichen Eingliederung bzw. zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit geboten. Ab dem 1.1.2018 wird sog. das Budget für Arbeit als gesetzliche Teilhabeleistung als gesetzliche Sozialleistung erbracht (Lohnkostenzuschuss bis 75 %).
- Im Bereich der Ausbildung gibt es u.a. Leistungen zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, der Beratung der Lehrer und Ausbilder
- Finanzierung von Gebärdendolmetschern oder die Finanzierung von persönlichen Schul- oder Studienassistenten
Hier geht es zu unserem Ressort Sozialrecht: https://www.anwaltskanzlei-wue.de/rechtsgebiete/sozialrecht/
Wohngeld für Mieter in den Regionen Mainfranken und Main-Rhön
Wohngeld nach dem WoGG
Einkommensschwache Bürger haben gegebenenfalls gegen ihre Gemeinde Anspruch auf Wohngeld, wenn sie Mieter sind oder auf Lastenzuschuss, wenn sie ein Hausgrundstück oder ähnliches benutzen. Daher haben auch Rentner, anders als Hartz IV-Empfänger, Anspruch auf Wohngeld. 0,9 % aller bayerischen Haushalte beziehen bereits Wohngeld!
Hartz IV-Empfänger haben Anspruch auf Bezahlung angemessener Kosten der Unterkunft. Hier zu den KdU
Sozialrechtliche Leistung für Mieter
Fachanwalt für Sozialrecht Christopher Richter, LL.M.Eur. stellt Ihnen in diesem Beitrag diese interessante Sozialleistung vor und erklärt, wie Sie sie bekommen und in welcher Höhe.
Mieter, Untermieter oder Heimbewohner erhalten den Mietzuschuss, Haus- oder Wohnungseigentümer den sogenannten Lastenzuschuss. Die Mehrheit der Antragssteller sind erfahrungsgemäß Mieter, deren Anspruch sich danach richtet mit wie vielen Haushaltsmitgliedern sie zur Miete wohnen wie hoch die Miete ist und vorallem wie hoch das Gesamteinkommen ist.
Wohngeld in Schweinfurt, Würzburg und Bad Kissingen
Die zuschussfähige Miete bestimmt sich nach Bruttokaltmiete und den sonstigen Nebenkosten, also ohne Warmwasser und Haushaltsenergie. Dabei gibt es Höchstbeträge der Miete, die nach sechs Kategorien gestaffelt sind. In Würzburg etwa gehört zur Kategorie IV, so dass eine Wohnung bei drei Mietern nicht mehr als 708 € Bruttokaltmiete (inkl. Entlastung Heizkosten, Klimakomponente dann 907,80 €) kosten darf. Bei 4 Bewohnern 825 € (inkl. Entlastung Heizkosten, Klimakomponente 1057,20 €).
Die Stadt Schweinfurt zählt zur Kategorie II, dort gibt es bei drei Bewohnern bis 501,00 € bzw. 700,80 € (inkl. Entlastung Heizkosten, Klimakomponente) und bei vier Bewohnern 825,00 € bzw. 1.057,20 €.
Auch die Stadt Bad Kissingen und der Landkreis Würzburg gehören zur Kathegorie 2.
Wohngeld in Bad Neustadt, Karlstadt und den Haßbergen
Die Kreise Bad Neustadt, Karlstadt, Haßberge und der Landkreis Schweinfurt zählen zur ersten Kategorie (3 Personen: 501 € bzw. 700,80 €; 4 Personen: 584 € bzw. 816,20 €).
Wohngeldstellen die Berechnung überlassen
Tipp vom Anwalt: Wegen Abzugspauschalen (bei Arbeitnehmern ein jährliche Steuerfreibetrag von 1.000 € etwa), Freibeträgen etc. ist das persönliche Gesamteinkommen für den Laien nicht rechtssicher ermittelbar. Kindergeld und Kinderzuschlag, Pflegegeld sowie Steuerrückzahlenungen zählen ohnehin nicht mit. Dagegen aber Unterhalt, Renten oder Pensionen und irgendwelche Einmalzahlungen. Nach einer Entscheidung des VG Braunschweig vom 26.02.2015 dürfen jedoch nur tatsächlich zur Verfügung stehende Einkünfte berücksichtigt werden und nicht etwa Kapitalerträge von gar nicht verfügbaren Sparkonten (Az.: 3 A 166/14).
Sie sehen: Es ist kompliziert! Überlassen Sie die Berechnung daher zunächst den Profis in den Wohngeldstellen und suchen Sie nur im Falle von Unstimmigkeiten hier anwaltliche Hilfe.
Unterlagen gleich mitvorlegen
Ausländer erhalten übrigens auch je nach ihrem Aufenthaltsort Wohngeld. Bei Selbständigen berechnet sich das Gesamteinkommen nach dem Gewinn der letzten drei Jahre. Gewöhnlich müssen neben Mietbescheinigung vom Vermieter, dem Mietvertrag, der Verdienstbescheinigung vom Arbeitgeber oder anderen Einkommensnachweise im Einzelfall Kontoauszüge, der Schwerbehindertenausweis und Darlehensverträge mit ersichtlichen monatlichen Belastungen vorgelegt werden.
Tipp vom Anwalt: Veränderungen, etwa der Miethöhe, bei der Zahl der Haushaltsmietglieder oder ihrem Einkommen teilen Sie unbedingt der Wohngeldstelle zeitnah mit, um ein Strafverfahren nach dem Entdecken durch den automatischen Datenabgleich zu vermeiden. Wer Falschaussagen zu seiner Lebenssituation macht, der muss damit rechnen, dass ihm das Wohngeld ganz versagt wird, wie der spektakuläre Fall einer am RTL2 „Frauentausch“ teilgenommenen Antragsstellerin vor dem Verwaltungsgericht Berlin (Az.: VG 21 K 285.14) gezeigt hat.
Wohngeld auch für Mieter mit Vermögen!
Wenn das Wohngeld weniger als zehn Euro beträgt bekommen Sie nichts. Ebenfalls kann es Probleme geben, wenn Sie erhebliches Vermögen besitzen. Die Verwaltungen setzen die Schwelle hier großzügig bei 60.000 € an und bei zusätzlichen 30.000 € für jedes weitere Haushaltsmitglied. Im Einzelfall lässt sich dies herrlich gerichtlich anfechten. 84.000 € sind nach dem Verwaltungsgericht Berlin vom 18.01.2011 jedenfalls zuviel (Az.: VG 21 K 431.10).
Tipp vom Anwalt: Wohngeldempfänger sollten gleich mit überprüfen lassen, ob sie Anspruch auf Rundfunkgebührenbefreiung haben!
Tipps zum Umgang mit Sozialämtern und Jobcentern. hier lesen:
Mehr Fragen zum Sozialrecht?
0931/47085337 oder richter@anwaltskanzlei-wue.de
hier geht es zu unserem Ressort Sozialrecht
Lotterie gesetzliche Unfallversicherung
Gesetzliche Unfallversicherung
Betroffene empfinden die gesetzliche Unfallversicherung oftmals als Lotterie, ob nach deren Entscheidung ein Arbeitsunfall vorliegt und so für die Rehabilitation und Verletztengeld gem. § 45 SGB VII gezahlt wird. Der in Würzburg und Schweinfurt im Sozialrecht tätige Rechtsanwalt Christopher Richter, LL.M.Eur. stellt Ihnen hier zwei überraschende Entscheidungen aus dem Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung vor.
Der Sturz vom Müllauto kein Arbeitsunfall i.S.d. § 8 I SGB VII
Eine gute Vorbereitung, bereits bei der Antragsstellung, ist alles. Ein Mitte 30-Jähriger könnte, wenn die höheren Instanzen die Entscheidung des Sozialgerichts Landshut bestätigen, ruiniert sein, weil sein Sturz beim Einladen von Sperrmüll nicht als Arbeitsunfall anerkannt wurde (SG Landshut vom 27.02.2017, Az.: S 13 U 133/15). Der Sturz sei auf ein innere Ursache des Versicherten, nämlich aufgrund Schwindels und allgemeinen Unwohlseins, zurückzuführen.
Krampfanfall als Ursache nicht nachgewiesen
Das “Genick gebrochen” hatte dem Kläger die Zeugenaussage seines Kollegens, der mehrfach erklärte, der Kläger sei nicht gestolpert, sondern praktisch aus heiterem Himmel umgefallen.
Innere als die wesentliche Ursache schädlich
Mit einer anderen Argumentation, nämlich etwa der Erklärung, dass eine besonders stinkende Tonne das Unwohlsein des Klägers hervorgerufen hat, wäre aber auch eine andere Entscheidung denkbar gewesen; daher sollte man sich als Betroffener in solchen Fällen nur von einem im Sozialrecht erfahrenen Rechtsanwalt vertreten lassen.
Autounfall beim Sonntagsspaziergang ist Arbeitsunfall
Auf den ersten Blick ist es daher überraschend, dass das Sozialgericht Düsseldorf kürzlich einen Sonntagsspaziergang als Arbeitsunfall einstufte (SG Düsseldorf vom 20.06.2017, Az.: S 6 U 545/14).
Auch bei Rehabilitationsmaßnahme gesetzlich unfallversichert
Der Anfang 60-Jährige hielt sich zur stationären Rehabilitation in einem Rehabilitationszentrum auf. Am Therapie freien Sonntag überquerte er einen Zebrastreifen vor der Klinik und wurde von einem PKW so schlimm angefahren, dass er u.a. eine Lungenkonfusion und diverse Zahnfrakturen erlitt. Die gesetzliche Unfallversicherung wollte zunächst nicht zahlen, weil der Spaziergang eine eigenwirtschaftlich, unversicherte Tätigkeit sei.
Nach erfolglosem Widerspruch erhob der Mann Klage vorm Sozialgericht und obsiegte. Der sachliche Zusammenhang zur Therapiemaßnahme war nicht aufgehoben durch den therapiefreien Sonntag, urteilte der Sozialrichter, denn der Spaziergang diente dem stark übergewichtigen Mann – auch nach Empfehlung der Ärtzte – sein Behandlungsziel zu erreichen.
Tipp vom Anwalt:
Lassen Sie sich daher bereits bei der Antragsstellung bei der gesetzlichen Unfallversicherung beraten. Im Falle des Widerspruches und der Klage kommt es gerade bei der Frage der Kausalität auf eine kluge Argumentation an, weil die gesetzliche Unfallversicherung jedes falsche Wort im Zweifel auf die Goldwaage legt und Ihren Anspruch dann rasch ablehnt. Lassen Sie sich daher kompetent beraten.
Kontakt: richter@anwaltskanzlei-wue.de
Tel.: 0931/47085337
hier geht es zu unserem Ressort Sozialrecht: Sozialrecht