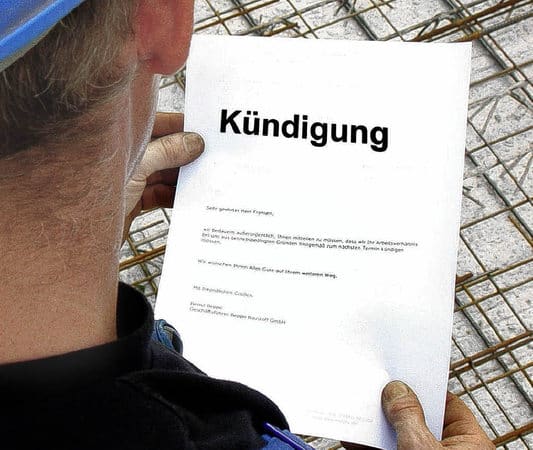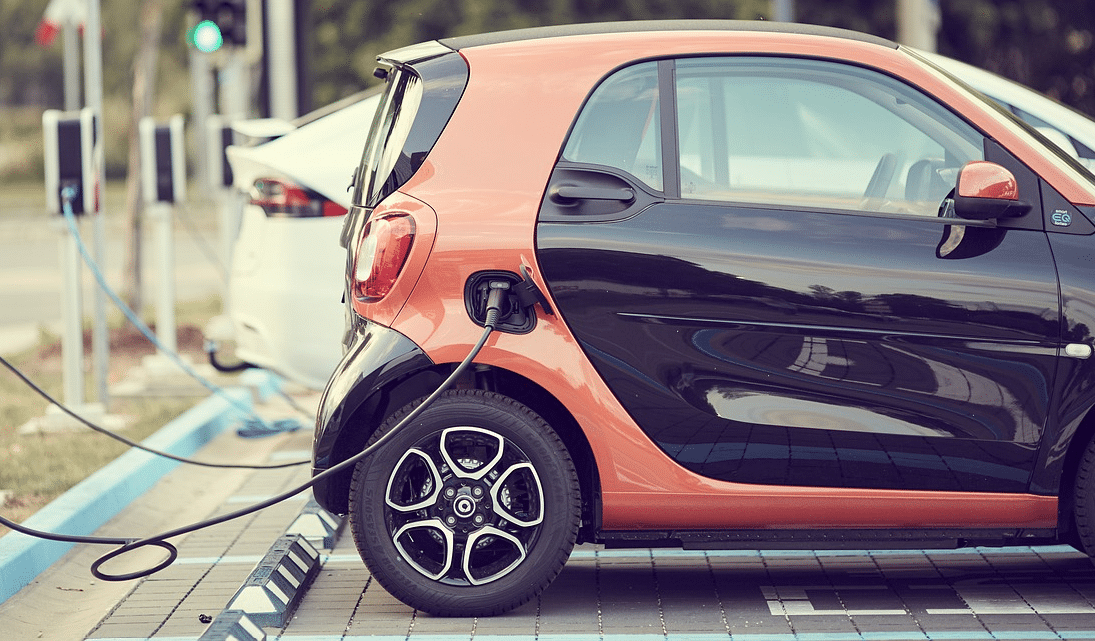Von Gerichten wird gerne pauschal behauptet, dass Eilverfahren einen geringeren Umfang haben. Das ist oftmals unrichtig, denn der Rechtssuchende muss häufig bei der Erstellung einer eidesstattlichen Versicherung unterstützt werden, was im Hauptsacheklageverfahren nicht der Fall ist. Im Übrigen tauchen auch schwierige rechtliche Erwägungen auf, wie der folgende Fall (vereinfacht) zeigt.
Behörde stoppte Sozialhilfezahlungen
Bei einem Sozialhilfeempfänger wurden nachdem ihm ein Leistungsbescheid zuging die Sozialhilfezahlungen gestoppt, weil auffiel, dass er eine größere Summe von seinem Konto abgehoben hatte. Dagegen wendete sich der schwerbehinderte Senior, der seit fast zwei Jahrzehnten von Sozialhilfe lebt, mit seinem Antrag. Der pflegebedürfte Niederbayer, der mit rund 500 € eine Minirente bezog, war also ein sogenannter „Aufstocker“. Seine Verteidigung ging dahin, dass er einen mittleren vierstelligen Betrag von einem namentlich nicht benannten Bekannten aufbewahrt habe und ihm das Geld dann zurückgegeben habe.
Beträge angespart durch Hilfebedürftigen
Während des Verfahrens stellte das Gericht fest, dass der Kläger irgendwann dadurch, dass er sparsam gewirtschaftet hatte – und noch freiwillige Zahlungen eines ihn unterstützenden Vereins erhielt – einen Betrag angespart hatte, der den Freibetrag von 5.000,00 € überstieg.
Der Richter am Sozialgericht sezierte den Eilantrag des Mannes und unterschied nach drei Zeiträumen: vor Eilantragsstelllung (a), ab Eilantragsstellung bis zum Ende des Bewilligungszeitraums des Leistungsbescheides (b) und den nach Ende des Bewilligungszeitpunkte (c).
Nachholbedarf nicht gegeben
Leistungen, die aus der Vergangenheit vor Eilantragsstellung stammen, zu bekommen, haben Kläger in der Regel schlechte Karten. Nur ausnahmsweise bei einem Nachholbedarf, d.h. wenn die Nichtgewährung in der Vergangenheit in die Gegenwart fortwirkt und eine gegenwärtige Notlage bewirkt (z.B. es wurden bereits Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen rückständiger Schulden gegen den Hilfesuchenden eingeleitet oder stehen unmittelbar bevor) kann dies mal anders sein. Einen solchen konnte der Antragssteller aber laut Gericht nicht geltend machen, so dass er hier deutlich unterlag.
Verwertbares Vermögen war vorhanden
Keine Chance hatte der Eilantrag, soweit er den Zeitraum nach dem Bewilligungszeitraums erfasste. Hier stellte das Sozialgericht fest, dass dem Anspruch die Pflicht des Mannes entgegenstehe sein verwertbares Vermögen nach § 43 I 1 i.V.m. § 90 SGB XII einzusetzen. Dabei fiel dem Mann auf die Füße, dass er weder die angebliche Einzahlung des Geldes seines Bekannten, noch dessen angeblichen Verbrauchs nachweisen konnte.
Corona: Erleichteter Zugang zu Sozialleistungen
Tipp vom Anwalt: Für Neuanträge gilt aufgrund § 141 II 1 SGB XII (erleichteter Zugang zu Sozialleistungen) noch, dass nicht erhebliches Vermögen für sechs Monate nicht zunächst verbraucht werden muss, auch wenn es den Freibetrag übersteigt. Diese Sonderregelung gilt allerdings wohl nicht für Folgeanträge, da die Regelung (wie auch § 67 II SGB II) in erster Linie nur auf die Entlastung von Personen abzielt, die sich nicht bereits vor Verbreitung des Coronaviurus SARS-CoV-2 in einer wirtschaftlichen Notlage befunden haben (str.).
Schonvermögen überschritten
Der Sozialrichter sah beim Kläger ein das Schonvermögen von 5.000,00 € übersteigenden Vermögen, da das abgehobene Geld ihm nach Ansicht des Gerichts weiter zur Verfügung stehe und nicht verbraucht sei. Er habe nicht bei der Benennung des Bekannten, dem der abgehobene Betrag angeblich gehöre, nicht mitgewirkt und so die Sachaufklärung verhindert. Der Vortrag ihm stehe das Geld nicht mehr zur Verfügung sei daher nicht nachgewiesen und nach den Beweislastregeln könne er auch gegen die Verwertung nicht den Einwand der Härte führen.
Tipp vom Anwalt: Im Einzelfall kann die Herkunft von Vermögen dieses so prägen, dass dessen Verwertung eine Härte nach § 90 III 1 SGB XII darstellen kann. Das reine Ansparen durch Konsumverzicht fällt allerdings gewöhnlich nicht darunter.
Sicherungsanordnung wurde erlassen
Einen Erfolg konnte der Mann allerdings erzielen, was den Zeitraum der Eilantragseinreichung bis zum Ende des Leistungszeitraums des Bewilligungsbescheides anging, da bei der Sozialhilfe – anders als in der Grundsicherung – keine Norm vorhanden ist die Auszahlung einmal bewilligter Leistungen vorläufig zu stoppen. Die Nichtauszahlung führe zu einer Zustandsänderung, nicht aber zu einer Rechtsänderung, weshalb das klägerische Begehren mit dem Antrag auf Erlass einer Sicherungsanordnung gem. § 86b II 1 SGG durchzusetzen sei.
Tipp vom Anwalt: Wenden Sie sich in einer derartigen Fällen zunächst grundsätzlich an die Verwaltung und stellen sie einen Folgeantrag auf die Sozialleistung. Nur ausnahmsweise, wie hier, wo der Eilantragssteller aufgrund seiner Kommunikation mit der Behörde davon ausgehen konnte, dass eine außergerichtliche Lösung nicht zu erwarten ist, liegt das Rechtsschutzbedürfnis für einen Eilantrag vor.
Gericht: Rechtsvereitelung durch Sozialamt
Weil kein Aufhebungsbescheid durch die Behörde ergangen war, sah das Sozialgericht in der Nichtauszahlung der Sozialhilfe die Gefahr einer Rechtsvereitelung durch die Behörde, weil die fällige Leistung ohne Rechtsgrundlage nicht ausgezahlt wurde.
Tipp vom Anwalt: Der im Rahmen des Eilverfahrens nachzuweisende Anspruch und Grund der Eilbedürftigkeit stehen in einem Wechselverhältnis. Wenn der Anspruch offensichtlich besteht, sind an den Anordnungsgrund nur geringe Anforderungen zu stellen. Wenn es hierbei um existenzsichernde Leistungen geht, ist der Anspruch auf Sozialhilfe – hier Hilfen im Alter – grundsätzlich abschließend zu prüfen und nur wenn eine vollständige Aufklärung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht möglich ist, eine Folgenabwägung treffen, ob eine Grundrechtsverletzung für den Antragssteller ansonsten droht.
Hier mehr zum Thema Hartz IV
Hinweis: Dieser Beitrag berichtet über die Gerichtsentscheidung des SG Landshut (Az.: S 3 SO 39/21 ER) . Er stellt keine Rechtsberatung dar. Für Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht gehaftet. Lassen Sie sich auf jeden Fall individuell beraten.