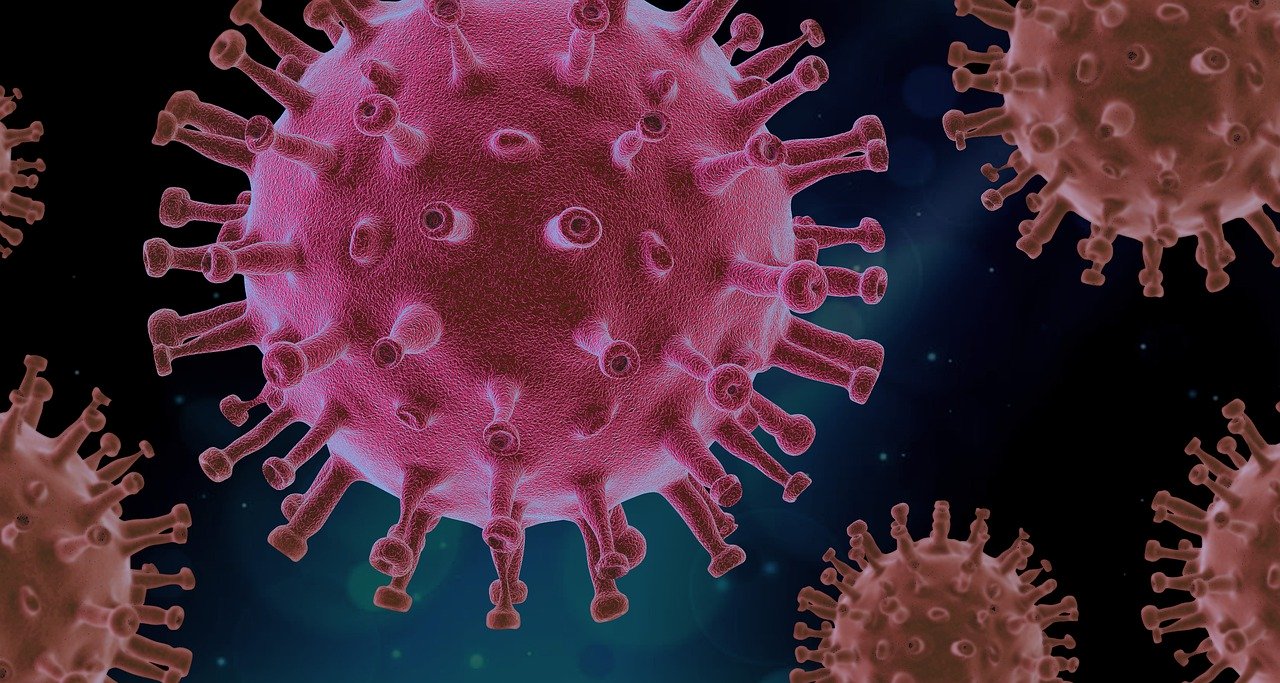Sozialversicherungsrechtliche Fragen im Rahmen der Gründung
Bei der Gründung sollte man auch sozialversicherungsrechtliche Überlegungen anstellen, auch wenn dies sich erstmal langweilig anhört.In diesem Beitrag will ich für Gründer darstellen, warum es sich sehr wohl lohnt mit diesem Thema zu beschäftigen und warum Wissenslücken hier den Erfolg des eigenen Startups gefährden können und wie die hohe Sozialabgabenlast etwas gedrückt werden kann.
Gewinn neuer Liquidität
In Deutschland besteht eine Krankenversicherungspflicht für Jedermann, auch für Selbständige. Wer aus einem Angestelltenverhältnis heraus ins freie Unternehmertum wechselt, der steht nicht nur vor der Frage, ob er sich privat oder gesetzlich krankenversichert, sondern sieht sich nun teils hohen Beitragsforderungen seiner Krankenkasse ausgesetzt.
Die Wahl, ob man sich privat oder gesetzlich krankenversichert kann auch Auswirkungen haben auf den krankenversicherungsrechtlichen Status von Angehörigen. Wechselt der Gründer etwa in die private Krankenversicherung, der Partner bleibt aber in der gesetzlichen Krankenversicherung werden Kinder in der Regel* dem Partner zugeordnet, der mehr verdient! Wird die Selbstständigkeit nur nebenberuflich ausgeübt, kann der Gründer in einer Familienversicherung der GKV bleiben, wenn er damit nur 455 €** monatlich verdient und maximal 18 Stunden/Woche für sein Startup arbeitet. Überschreitet der Gründer diese Grenze muss er sich doch wieder selber versichern. Die Versicherungspflicht beginnt mit dem Ergehens des relevanten Einkommenssteuerbescheids, der diese Grenzüberschreitung dokumentiert.
Bei Selbständigen gehen die Krankenkassen nur manchmal von einem Mindesteinkommen von 1.061,67 € aus. Der aktuelle Beitragssatz liegt ohne Ermäßigung bei 14,6 %. Für nebenberuflich Selbständige gibt es unter Umständen reduzierte Sätze. Die Beitragsbemessungshöchstgrenze liegt bei 4.687,50 €, was einen Krankenkassenbeitrag von maximal 684,30 € ergeben kann. Gerade Gründer, die aus einem gutbezahlten Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit wechseln, sehen sich u.U. hohen Krankenversicherungsbeiträgen ausgesetzt. Diese Beiträge sind zwar nur vorläufig festgesetzt, sie müssen aber erstmal gezahlt werden. Es empfiehlt sich daher einen Antrag auf Beitragsentlastung zu stellen, wobei man die zu erwartenden Einkünfte erstmal schätzen kann. Wer zu niedrig schätzt, wird sich aber später einer Beitragsnachforderung ausgesetzt sehen.
Bei den privaten Krankenversicherern sind die Tarife oft nicht einkommensabhängig und manchmal niedriger. Der Nachteil ist, dass der Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung oft schwierig ist, insbesondere weil private Krankenversicherungstarife häufig mit zunehmendem Alter steigen. Zudem ist es viel schwieriger seine Rechte im Streitfall gegen den Versicherer vor Gericht durchzusetzen, da den privaten Krankenversicherungen häufig lange Vertragswerke zugrunde liegen über die sich vielfach und lange streiten lässt.
Mit Compliance im Punkt Sozialversicherung Strafen und Bußgelder vermeiden
Compliance, also die Kontrolle der Einhaltung von Regeln, ist eines meiner Lieblingsthemen. Für Selbständige gibt es zwar eine gelockerte Sozialversicherungspflicht, d.h. viele Selbständige sind z.B. nicht rentenversicherungspflichtig, es gibt aber zahlreiche berufsgruppen- und berufsgruppenunabhänigige Ausnahmen. Wer also seine Rentenversicherungsbeiträge nicht oder nicht rechtzeitig abführt, der riskiert nicht nur hohe Nachzahlungen mit Säumniszuschlägen, sondern ggf. ein Bußgeld bis 2.500 € und im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. Schuldner kann der Selbständige sein oder auch der „Arbeitgeber“ im Falle von Scheinselbständigkeit.
Bestimmte Gründer müssen also spätestens drei Monate nach Aufnahme ihrer selbständigen Tätigkeit sich bei ihrem zuständigen Rentenversicherer mit allen relevanten Unterlagen melden. Wer das versäumt, dem droht nach § 320 SGB VI ein Bußgeld bis zu 2.500 €. Zudem kann die Rentenversicherung beim Gründer eine Betriebsprüfung durchführen und das Startup damit regelrecht lahmlegen. Diese Meldepflicht gibt es auch dann, wenn man als Angestellter durch seine nebenberufliche Selbständigkeit nun mehr verdient als im Hauptberuf oder hier mehr seiner Zeit verbringt.
Berufsgruppenabhängige Versicherungspflicht
Bestimmte Selbstständige sind kraft Berufes Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung, wie Künstler, Publizisten oder Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind. Zu Letzteren zählen Gründer, die einen zulassungspflichtigem Handwerksberuf nachgehen, also etwa Informationstechniker Karosserie- und Fahrzeugbauer, KfZ-Mechaniker, Elektrotechniker, Bäcker, Konditoren, Fleischer, Friseure, Raumausstatter oder Rolladen- und Sonnenschutztechniker. Geht man dieser Tätigkeit aber als Gesellschafter über eine in die Handwerksrolle eingetragene Kapitalgesellschaft, wie etwa einer GmbH oder einer KGaA nach, besteht hingegen nicht automatisch die Versicherungspflicht. Diese kann aber aus anderen Gründen entstehen, etwa wenn der alleinige Geschäftsführer nicht der Mehrheitsgesellschafter ist.
Auch wer sich als Lehrer selbständig macht, der ist in der Rentenversicherung Pflichtmitglied, wobei der Lehrerbegriff weit ausgelegt wird, so dass auch Golftrainer, viele Moderatoren, Trainer oder Supervisoren darunterfallen können.
Wer seine Leistungen im Bereich Kranken- oder Kinderpflege anbietet, der ist ebenfalls rentenversicherungspflichtig, wenn er überwiegend nach ärztlicher Anordnung handelt, also etwa Logopäden, Podologen oder Physiotherapeuten. Nicht darunter fallen Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. Wer aus diesem Bereich aber eine Hilfskraft über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus versichert, der fällt aus der Versicherungspflicht heraus.
Auch selbständige Hebammen und Entbindungspfleger sind per Gesetz rentenversicherungspflichtig.
Stellt der Rentenversicherungsträger die Sozialversicherungspflicht fest, sind vom Selbständigen rückwirkend die Beiträge nachzuentrichten, samt den Säumniszuschlägen.
Berufsgruppenunabhängige Versicherungspflicht
Hier spricht man häufig auch von „Scheinselbständigkeit“. In neuerer Zeit hat eine Entscheidung des Bundessozialgerichts für Aufregung gesorgt, dass auch selbständige Altenpfleger mit nur einem Auftraggeber unter die Versicherungspflicht fallen. Über die Frage, ob jemand überhaupt selbständig ist kann man trefflich streiten. Hier stellen sich dann Fragen, ob man ein unternehmerisches Risiko trägt, in den Betrieb des Arbeitgebers eingebunden ist oder von nur einem Auftraggeber extrem wirtschaftlich abhängig. Influencer, die die Software ihres exklusiven Partners nutzen, könnten darunter fallen; privilegiert dagegen sind Angehörige freier Berufe, wie Psychologen, Ärzte, Architekten oder Rechtsanwälte.
Stellt der Rentenversicherungsträger die Beitragspflicht als Angestellter dann fest, wird er den kompletten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil vom „Arbeitgeber“ verlangen. Bei einer Vielzahl von Scheinselbständigen, oftmals bei eingesetzten Honorarkräften z.B. an Privatschulen, wird häufig ein Summenbeschied ergehen, mit einer kalkulierten Pauschalsumme. Dieses Geld kommt aber nicht dem Scheinselbständigen zugute, sondern landet im allgemeinen Rententopf.
Wer mehrere rentenversicherungspflichtige Tätigkeiten ausübt, bei dem kann eine Mehrfachversicherung entstehen.
In den ersten drei Jahren nach der Gründung kann man sich auf die Sozialklausel der Rentenversicherung berufen und muss dann nur den halben Regelbeitrag von aktuell 296,21 € (2020) zahlen. Das darf man auch bei einer zweiten Gründung nochmal, wenn die Erste danebengeht. Die monatlichen Beiträge sind spätestens bis zum drittletzten Bankarbeitstag des relevanten Monats zu zahlen.
Soziale Absicherung
– Sich freiwillig bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern kann Sinn machen, weil man dann nach fünf Beitragsjahren u.U. einen Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente hat oder die Angehörigen nach dem eigenen Tod Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente. Wer später im Alter auf die Grundsicherung angewiesen ist, der profitiert seit 2018 auch mehr von der freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung, weil Einkommen daraus weniger stark angerechnet wird. Diesen Antrag auf freiwillige Versicherung muss man allerdings bis spätestens fünf Jahre nach Beginn der selbständigen Tätigkeit stellen; wenn man den vollen Erwerbsminderungsschutz haben will, sogar nach nur zwei Jahren. Klar gibt es auch private Konkurrenzangebote zu den staatlichen Versicherungsprodukten, die haben aber auch ihre Nachteile.
– Innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Gründung können Sie auch einen Antrag auf eine freiwillige Arbeitslosenversicherung stellen, wenn sie innerhalb der letzten 2 ½ Jahre mindestens zwölf Beitragsmonate bei der DRV hatten.
– Der Abschluss der gesetzlichen Unfallversicherung sollte unbedingt geprüft werden, wenn Sie einen Beruf ausüben, der mit der Gefahr verbunden ist, einen Unfall zu erleiden. Einige Gründer sind übrigens bereits kraft Gesetzes oder durch die Satzung der Berufsgenossenschaft***, der sie angehören, in der gesetzlichen Unfallversicherung pflichtversichert, wie etwa manche Existenzgründer im Gesundheitsbereich, z.B. Logopäden oder Physiotherapeuten als Unternehmer in Heil- und Pflegeberufen, aber auch Friseure und Landwirte. Eine freiwillige Versicherung ist auch hier möglich.
Weil Unfälle im privaten Bereich hier ausgeklammert sind, ist der Abschluss einer zusätzlichen Unfallversicherung für die Freizeit, ob privat oder als Zusatzangebot der gesetzlichen Unfallversicherungsträger, durchaus sinnvoll. Sich rein privat Unfall zu versichern ist möglich, aber man muss aufpassen das Klauseln* im Vertragswerk stehen können, die einem den Versicherungsschutz im Ernstfall nehmen.
* Ausnahme der der mehr verdient liegt damit unter der Jahresentgeltgrenze von 62.550 € (2020)
** bei Künstlern und Publizisten liegt die Grenze nur bei 325 €
*** Gemeint sind Klauseln, wie die Alkoholklausel, die bei jedem Alkoholkonsum zur Leistungsablehnung führt, die Eigenbewewegungsklausel, die Unfälle aufgrund falscher eigener Bewegungsabläufe ausschließt oder bestimmte Altersbeschränkungen
**** Etwa nach § 43 der Satzung der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewebe ist die gesetzliche Unfallversicherung für einige Unternehmer, insbesondere aus dem Bereich Fleischbe- und -verarbeitende Betriebe verpflichtend
Dieser Beitrag ersetzt keine Beratung im Einzelfall und dient nur Ihrer groben Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Ausführungen wird daher nicht gehaftet.
Mehr Infos hier